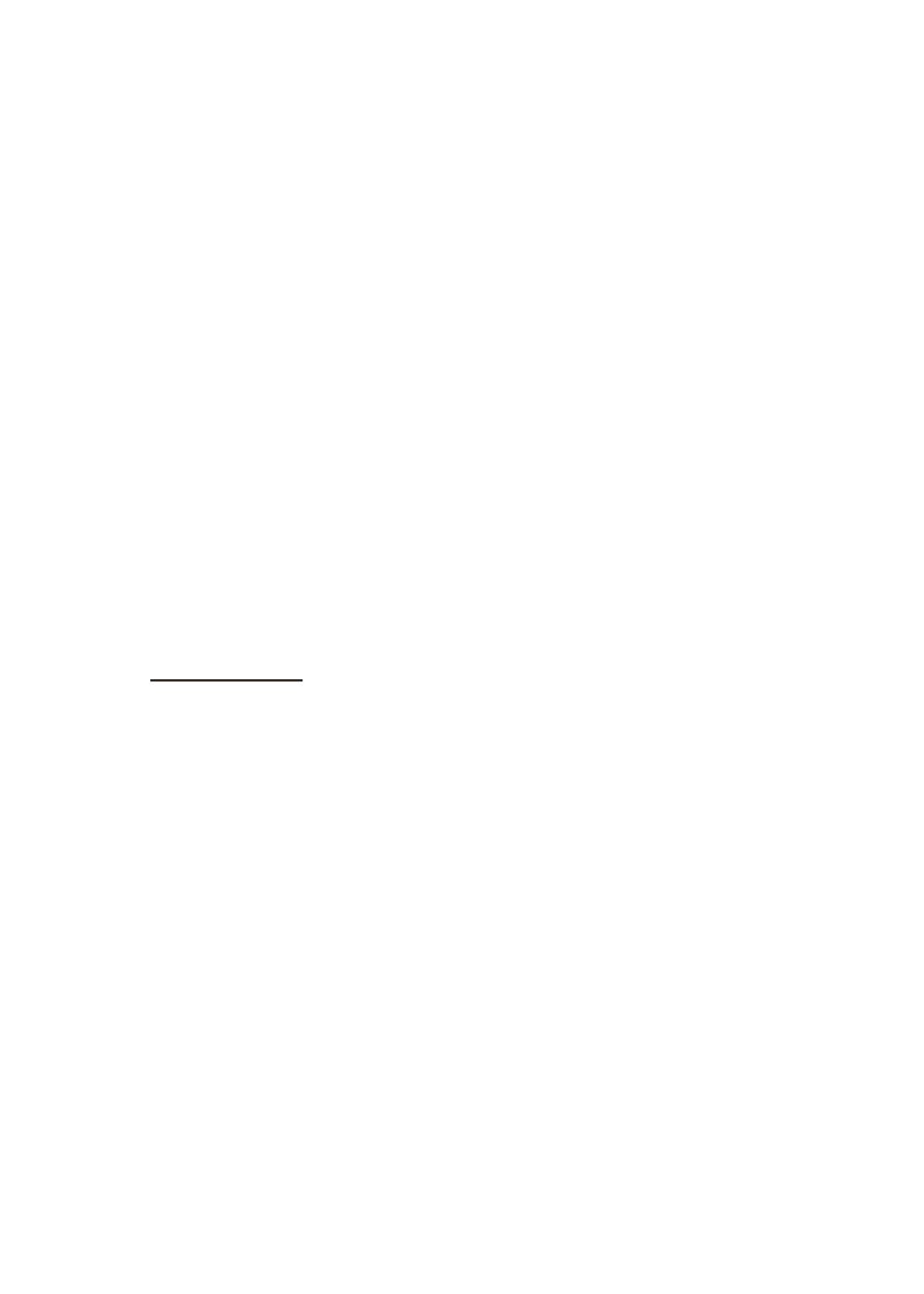
481
Wir erreichen mit diesem Konstruktionselement eine Blickverlängerung – von der
bürgerlichen Natur- und Gartenidealisierung der „Luise“ hin zur Ideal-Antike.
Kabinett 5:
Revolution und Humanismus. Sturm auf die Bastille
Wir gestalten einen erdbebenartigen Riss im Boden. Wir nehmen damit ein brisan-
tes, in seiner Bedeutung konventionalisiertes Symbol auf. Die erste Begegnung
der Deutschen mit der Französischen Revolution war der Sturm Pariser Bürger auf
das französische Staatsgefängnis am 14. Juli 1789. Spitzhacken gruben sich in das
Gemäuer der verhassten Bastille. Wir tragen neben dem nachgebildeten Turmriss
jeweils Pro- und Contra-Meinungen deutscher Schriftsteller zur Französischen
Revolution auf. Eine inwendig eingebaute Hörglocke in französischen Farben
lässt – je nach Bedienung – Vossens „Hymnus an die Freiheit“ als Nachdichtung
der Marseillaise/Gesang der Neufranken (1793) bzw. die Marseillaise erklingen,
letztere gesanglich interpretiert von Mireille Mathieu. Stark eingekürzt bietet die
Hörstation zudem Stefan Zweigs novellistische Erzählung der Entstehung der
Marseillaise, eine „Sternstunde der Menschheit“, professionell von einem Schau-
spieler gelesen. Der weitere Fragestellungen einbeziehende Explikationsmarker
Lupe lädt zum Weiterdenken ein.
54
54
Wenige Jahre später setzt Voß in seinem „Gesang der Deutschen“ nicht mehr auf den radikalen
Umsturz aller Verhältnisse: „Vernunft, durchWillkür erst befehdet,/ Doch kühn und kühner, singt und
redet/ Von Menschenrecht, von Bürgerbund,/Von aller Satzung Zweck und Grund [...]./Nicht mehr
verfolgt wird Leh’r und Meinung,/ Nicht gilt für Gottesdienst ein Brauch;/Nur Lieb ist aller Kirchen
Einung,/ Der Tempel und Moskeen auch“ [...] „Nur Tugend, nicht Geburt, gibt Amt und Bürde.“
(Zit. nach Sämtliche poetische Werke, hg. von Abraham Voß. Nebst einer Lebensbeschreibung von
Theodor Schmid, Leipzig 1835, S. 184.) Diesen - sonst dem Adel entgegengehaltenen - Grundsatz
überträgt Voß nun auf die Staatsform. Monarchiekritik suchte die gesellschaftliche Verfassung
in fortschrittliche Bahnen zu lenken. Wie andere fortschrittliche Geister seiner Zeit gibt er die
Regierungsform Monarchie nicht auf, er verfolgt eine Reform der politischen Verhältnisse im
Rahmen der konstitutionellen Monarchie. Voß setzt in seiner Dichtung „Das Oberamt“ (1795)
die von ihm verfochtene Idee der Volkssouveränität gegen das Gottesgnadentum. Gegen eine
dynastisch ererbte und vererbbare Regentschaft und gegen eine Regierung, die sich in den Händen
eines einzigen Beamten konzentriert, setzt Voß die konstitutionelle Utopie der Mitbestimmung.
Mit einem solchen Wechsel erhält der Fürst sein herausgehobenes Existenzrecht allein durch die
Funktion, der Wohlfahrt und dem gesellschaftlichen Fortschreiten zu dienen. Das Volk delegiert
seine Macht und Majestät an den Regenten, von diesem dafür verlangend, die Kräfte des Staates
für das Gemeinwohl zu lenken. Und dies kontrolliert das Volk demokratisch („das Volksgesetz“,
in „Gesang der Deutschen“, ebd., S. 184). Die alte metaphysische Substanz erscheint so durch eine
moderne Funktion abgelöst. Damit ist Voß auf dem Weg zum modernen Verfassungsstaat. Eine
Regierungsform, bei welcher der Regent die Krone aus den Händen des Volkes erhalten sollte, ist
quasi eine gekrönte Republik.









