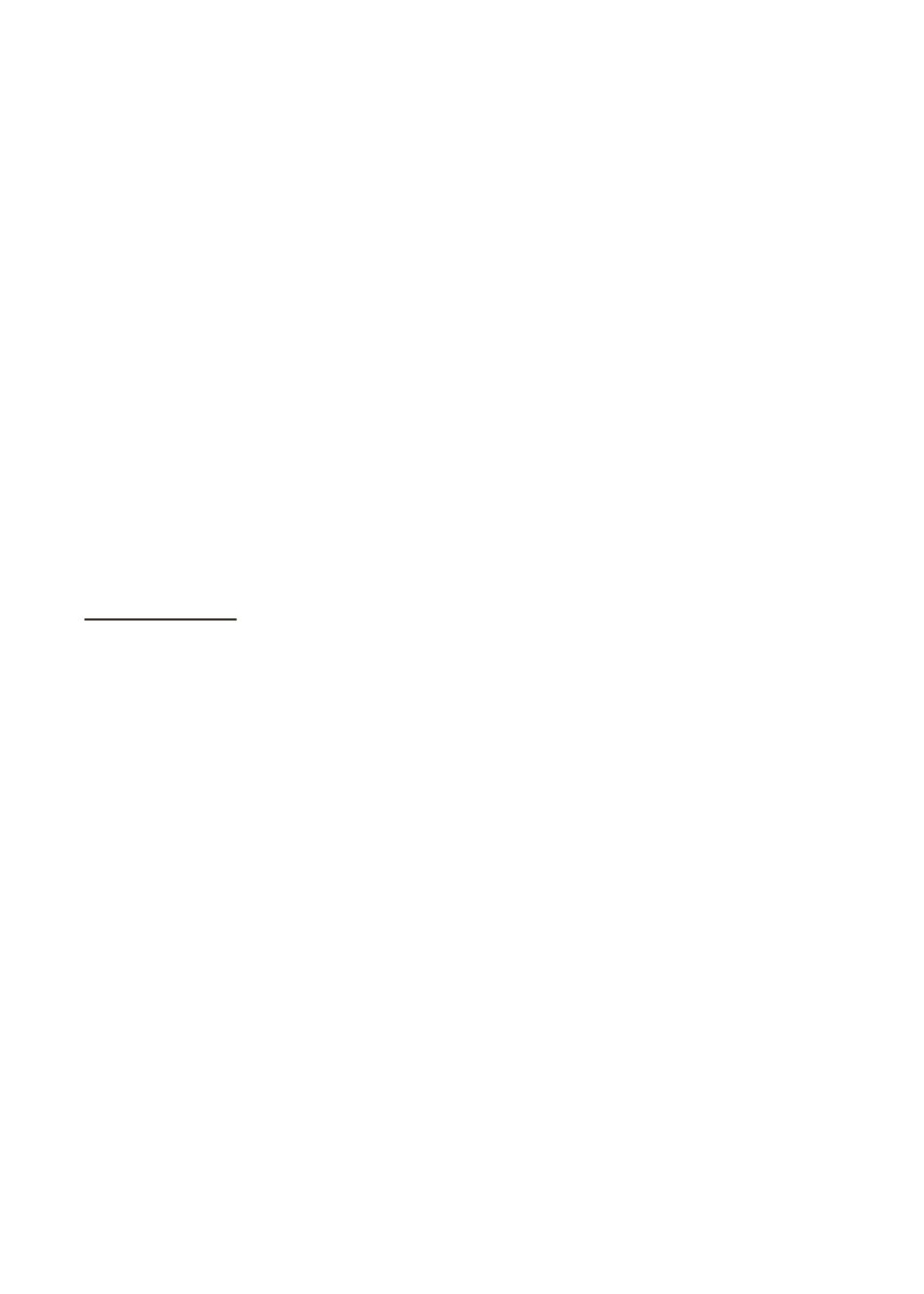
476
einen von uns aufbereiteten regionalen Quellentext, anwählbar am Lesescreen
der Bibliothek
38
Aus diesem kann erschlossen werden, was das Rechtsverhältnis
„Leibeigenschaft“ für die Menschen bedeutete.
39
Den damit erreichbaren pädago-
gischen Möglichkeiten gilt unser Interesse. Die Schüler erkennen Vossens schar-
fes sozialkritisches Hinsehen und seinen unbestechlichen Sinn für menschliche
Würde. Das sind zweifelsohne moralische Qualitäten. Und sie entdecken, dass es
literarische Formen und Gegenformen gibt, dass überlieferte Formen unter ande-
ren Zeitbedingungen neue Funktionen erhalten. Wir schaffen so einen Zugewinn
an historischem Verständnis nicht nur der Voß-Texte:
Auch im „Junker Kord“, ein „Gegenstück zu Vergils „Pollio“, hielt Voß sich sati-
risch-abbildend an die Realität des Landlebens. In seiner Travestie auf Vergils vier-
te Ekloge nutzt Voß römisches Gedankengut. Diesmal prangert er Schwächen, La-
ster und Leidenschaften eines Adelssprosses an, wobei er ein Bild von der Gleich-
förmigkeit landadliger Kultur erzeugt. Diese besteht – von Voß über eine Kette von
drei Generationen hinweg beobachtet – aus Unbildung, Dünkel, Naturausbeutung,
Menschenschinderei, der Schwängerung von Mägden, die, eine gängige Praxis
40
,
anschließend dem Hofmeister zur Heirat zugeschoben werden. In Vossens scharfer
Sicht liegt es dem Adel fern, Bauern und Bürger zur Kritik der bisherigen Zustän-
38
Staatsanzeigen. Einige Worte über die Lage der Leibeigenen in Mecklenburg. In: Allgemeiner
Anzeiger der Deutschen. Gotha. Montags den 17. März 1817.
39
Hier zusammengefasst: Leibeigenschaft oder Untertänigkeit ist ein Eigentumsrecht, welches auf
der Person eines Menschen haftet, wodurch er zu gewissen Diensten, Obliegenheiten und Zin-
sen gegen seinen Grundherrn verpflichtet ist. Dieses Eigentumsrecht besteht auch fort, wenn der
Grundherr aufhört Herr zu sein, sich aber bei dem Verkauf den einen oder anderen Leibeigenen
ausbedingt. Zu der Leibeigenschaft gelangt der Mensch: 1. durch Geburt, denn leibeigene Eltern
können nur leibeigene Kinder zeugen; 2. durch Heirat. Heiratet eine freie Person eine leibeigene,
so wird sie dadurch leibeigen. Wenn ein leibeigenes Mädchen von einem Freien sich schwängern
lässt, so wird das Kind leibeigen. Der Leibeigene darf das Gut oder Dorf, wo er geboren ist, oder
den ihm angewiesenen Dienst, ohne Erlaubnis seines Leibherrn nicht verlassen. Der Leibeigene
ist verpflichtet, Zeit seines Lebens zu bleiben und zu dienen da, wo er geboren wurde. Der Leib-
eigene darf ohne Erlaubnis keine andere Lebensart wählen, z. B. der Tagelöhner plötzlich den
Handwerksberuf, als worin er geboren ist. Er darf ohne Erlaubnis seines Herren nicht heiraten. Er
ist körperlichen Strafen unterworfen. Er ist als Bauer, wenn ihn sein Herr nicht auf Pacht gesetzt
hat, zu bestimmten Hand- und Spanndiensten verpflichtet, als Tagelöhner aber muss er gegen einen
Lohn zu Hofe dienen.
40
Verspottet wird die Heirat eines Landpfarrers mit einer abgelegtenMaitresse auch imHeldengedicht
„Wilhelmine oder der vermählte Pedant“ (1764) von M. von Thümmel. Oftmals sicherte dies
Existenz und Auskommen, was auch aus dem Schreiben eines schwäbischen Pastors an einen
Kollegen hervorgeht: „Eine schwangere Maitresse seines Patronatsherren heiraten zu können,
dünkt manchem als der höchste Glücksfall, der ihm begegnen könnte“. In Süddeutschland hatte
sich bereits als ständige Redensart gebildet: „Die Frau Pfarrerin hat den Konfirmationsunterricht
im Bett des Herrn Grafen bekommen“. Zit. nach Leo Balet/ E. Gerhard: Die Verbürgerlichung der
deutschen Kunst, Literatur und Musik, Dresden 1979, S. 39. Dort ohne Quellenangabe.









