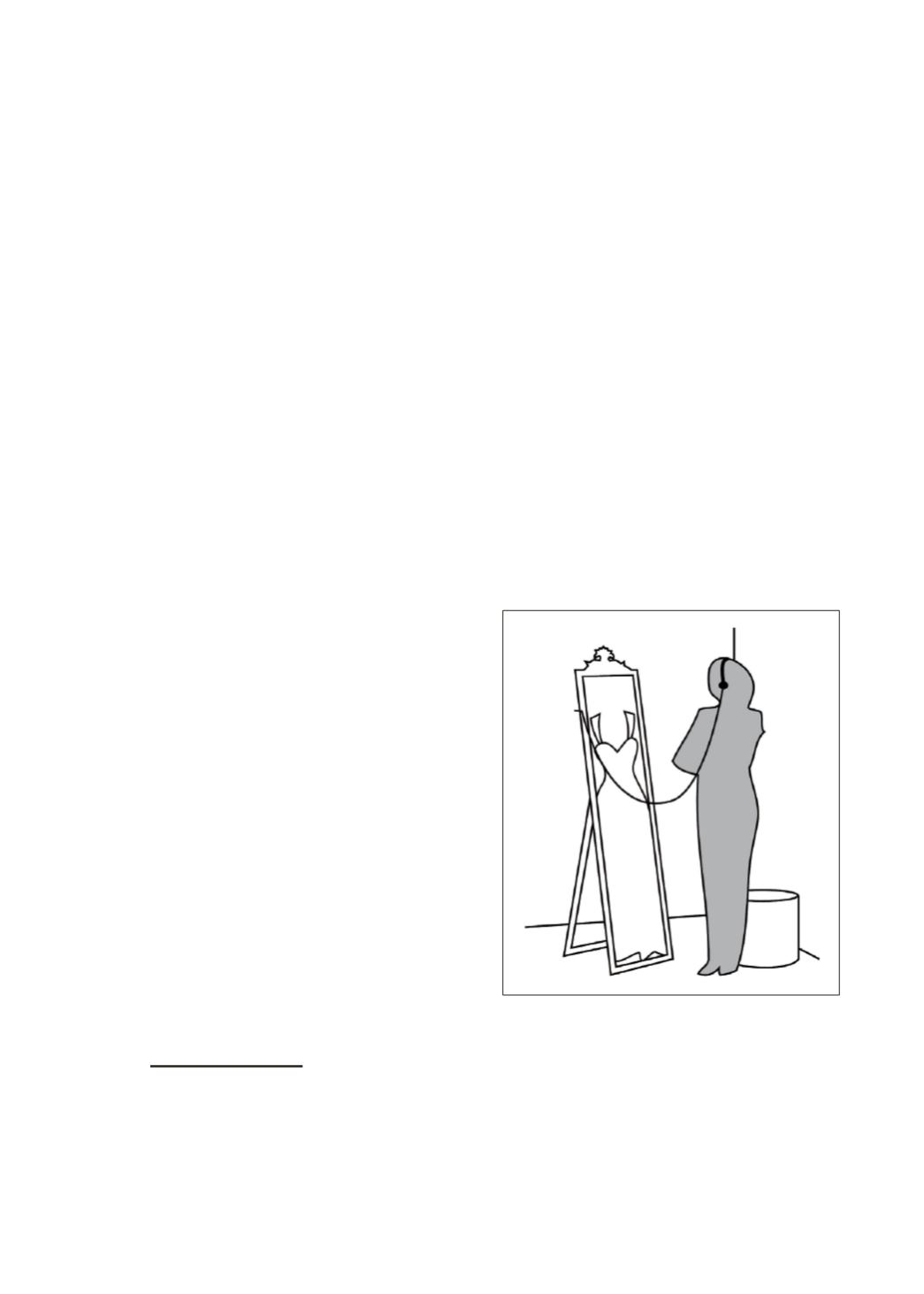
479
mich einen kleinen Strohsessel aus der Küche zu stellen. Wie oft hat Voß noch in
späteren Jahren ausgesprochen, dass unser Leben bis zum Junius den Namen der
Flitterwochen verdiente!“
49
Ein Touchscreen in Buchoptik präsentiert 6 Blätter der „Luise“, gezeichnet von
Daniel Chodowiecki. Diese bieten bereits einen Schlüssel zum Verständnis dieser
Dichtung. Sie zeigen eine begrenzte Anzahl nichtständisch agierender Personen in
typisch idyllischer Szenerie. Aus Chodowieckis Illustrationen und dem beigege-
benen Kommentar erschließt sich: Pfarrhausidyllen verdichten Sozialutopien. In
ihnen gewinnen egalitäre Momente der Freundschaft, der Familie und ein bürger-
liches Eheideal an Bedeutung. Voß gestaltet in der Wohlhabenheit und im Selbst-
bewusstsein des Pfarrers, im harmonischen Miteinander der Familienmitglieder
und im freundlichen Verhältnis zum benachbarten Grafengeschlecht – dem Cha-
rakter der Idylle gemäß – eine Wunschvorstellung, der eine anders geartete Wirk-
lichkeit als Gegenpol gegenübersteht.
50
Er bietet im Modell von Freundschaft und
Familie Vorgriffe auf die bürgerliche Gesellschaft. Bürgerlich ist auch die (neue)
Eheauffassung als Liebesbund. Voss gestaltet mit der achtzehnjährigen Luise und
ihrem Bräutigam, dem jungen Pfarrer Walter, Übereinstimmung der Charaktere,
gegenseitige Anziehung, mündend in sexuelles Begehren. Die ländliche Natur –
seit Rousseau idealer Aufenthaltsort des unverdorbenen Menschen – lockt Emp-
findungen hervor und macht bestehende
Neigungen rege. Dass Voß das Begeh-
ren der jungen Brautleute nicht ausspart
– ihr Verlangen nach Umarmung bewegt
den Brautvater und Pfarrer, das Paar be-
reits am Polterabend außerkirchlich zu
trauen – zeigt Vossens menschlichen
Realismus. Hier ist Echtheit, Lebendig-
keit, reale Körperlichkeit, hier sprechen
Menschen unverhüllt und unverblümt.
Es ist – so verstanden – ein Heutiges,
das den Besucher fesseln kann.
Eine Spiegelinstallation unterbreitet
ein geschlechtspositioniertes Angebot.
Während die junge Besucherin vor dem
Spiegel in das Brautkleid hineintritt
(Abb. 5), ein Selfie kann geschossen
49
Zit. nach Briefe von Voß. Nebst erläuternden Beilagen, hg. von Abraham Voß. Erster Band. Halber-
stadt 1829, S. 34.
50
Günter Häntzschel: Homer imWohnzimmer. In: Voß’Übersetzungssprache, S. 125-140, hier: S. 129.
Abb. 5 – Spiegel









