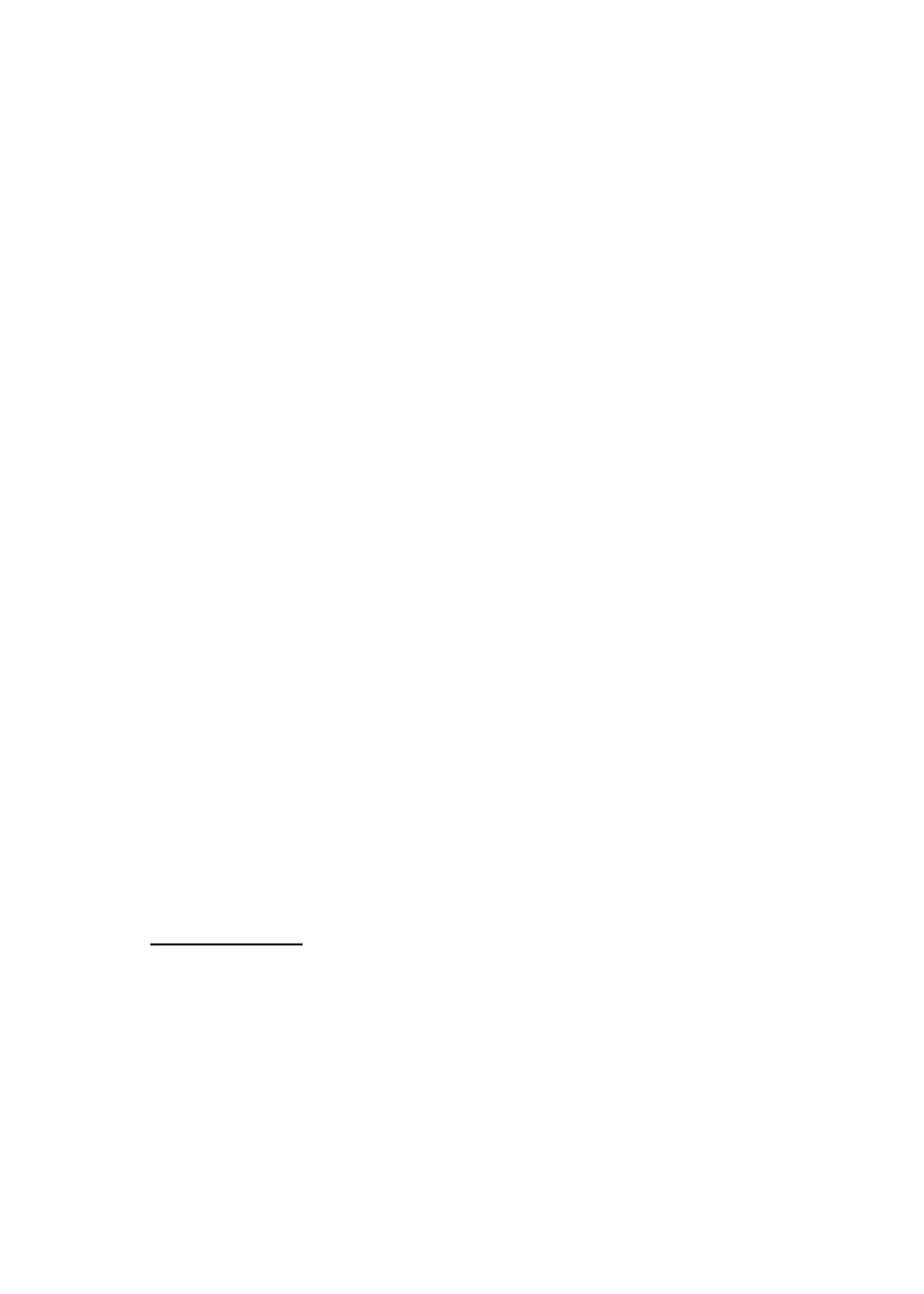
475
Zur Textform Idylle, zur Herkunft, Dichtung und Wirkung Theokrits, zum Sachbe-
reich Motiv und Motiventfaltung und zu weiteren Fragen könnten Schüler huma-
nistischer Gymnasien im Ausstellungsbereich und am Lesescreen der Bibliothek
arbeiten.
Eine kleine Informationstafel zur Gattung „Idylle“
35
berät Schüler anderer Schul-
arten dabei, die „Pferdeknechte“ als Antiidylle zu lesen, die das idyllische Gat-
tungsmuster umkehrt. Mit einem anmutigen Bild ländlicher Natur am Vorabend
eines Festes setzen „Die Pferdeknechte“ ein: Nichts aber ist in diesem Bild von
der zeittypischen, für die vielen Mond-Gedichte charakteristischen sentimentalen
Stimmung geblieben. Die Schäfer der in Salomon Geßners Idyllen fortlebenden
bukolischen Tradition ersetzt Voß durch das Personengespräch Leibeigener, die
Spanndienste leisten und die keine griechischen, sondern heimische Namen tra-
gen. Sichtlich ist der Stoff von den Zeitideen der Antityrannendichtung des Sturm
und Drang geprägt. Aber Voß sättigt diese mit sozialer Wirklichkeit.
36
Er gestaltet,
wie der Junker den jungen Stalldienste leistenden Knecht nicht nur um den ver-
sprochenen Freikauf, sondern auch um die geleistete Fronarbeit prellt. In die Pole
Freiheit und Determination ist die Tragik dieser Dichtung eingespannt. Während
das geliebte Mädchen, eine freie Person, singend ihr Brautkleid bleicht, beklagt
Michel, dass er keineswegs die gegen eine Freikaufsumme versprochene Freiheit
erhielt. Mittels betrügerischer ökonomischer Knebelung sichert der Grundherr ein
Weiterbestehen der persönlichen Unfreiheit seines Untertanen. Im antiken Rhyth-
mus steigert der empörte Knecht seinen Hass bis zu revolutionären Gewaltbildern
der Brandschatzung: „Ich lasse dem adlichen Räuber/ Über das Dach einen rothen
Hahn hinfliegen, und zäume/ Mir den hurtigsten Klepper im Stall, und jage nach
Hamburg.“
37
Hamburg war damals ein Zufluchtsort für entlaufene Leibeigene. Der
Dialogpartner, der Knecht Hans, kann die Bluttat durch christlichen Einspruch
gerade noch verhindern: Gott allein sei die Instanz, die für Gerechtigkeit sorge.
Die Klage des Leibeigenen richtet das Augenmerk des Lesers auf das wirksame
Rechtsverhältnis. In der Bibliothek erhalten Schüler diesbezüglich Einblicke.
Um einen schulisch wirkenden Geschichtstext zu vermeiden, verweisen wir an
35
Diese erklärt, dass die Idylle eine Gattung der altgriech. Literatur ist, die in kürzeren Texten ein
ländliches, bescheiden-natürliches Leben in anmutigen Bildern schildert, teils heiter, teils burlesk,
oft von hymnisch-liedhaftem Charakter und in Hexametern verfasst. In der deutschen Literatur des
18. Jahrhunderts will die Idylle mit ihrer Harmonie zwischen Mensch und Natur eine Gegenwelt
zur ständischen Gesellschaft schaffen und ein bürgerliches Lebensgefühl zum Ausdruck bringen.
36
Siehe hierzu den Beitrag von Ernst Münch. Sommerstorf – Penzlin – Neubrandenburg – Ankersha-
gen. Die mecklenburgische(n) Lebenswelt(en) des Johann Heinrich Voß. In: Hans-Joachim Kert-
scher, Andrea Rudolph (Hg.): Heute in Penzlin daheim. Morgen in der Welt zu Hause, S. 81-112.
37
Zit. nach Adrian Hummel (Hg.): J.H. Voß. Ausgewählte Werke, Göttingen 1996, S. 9.









