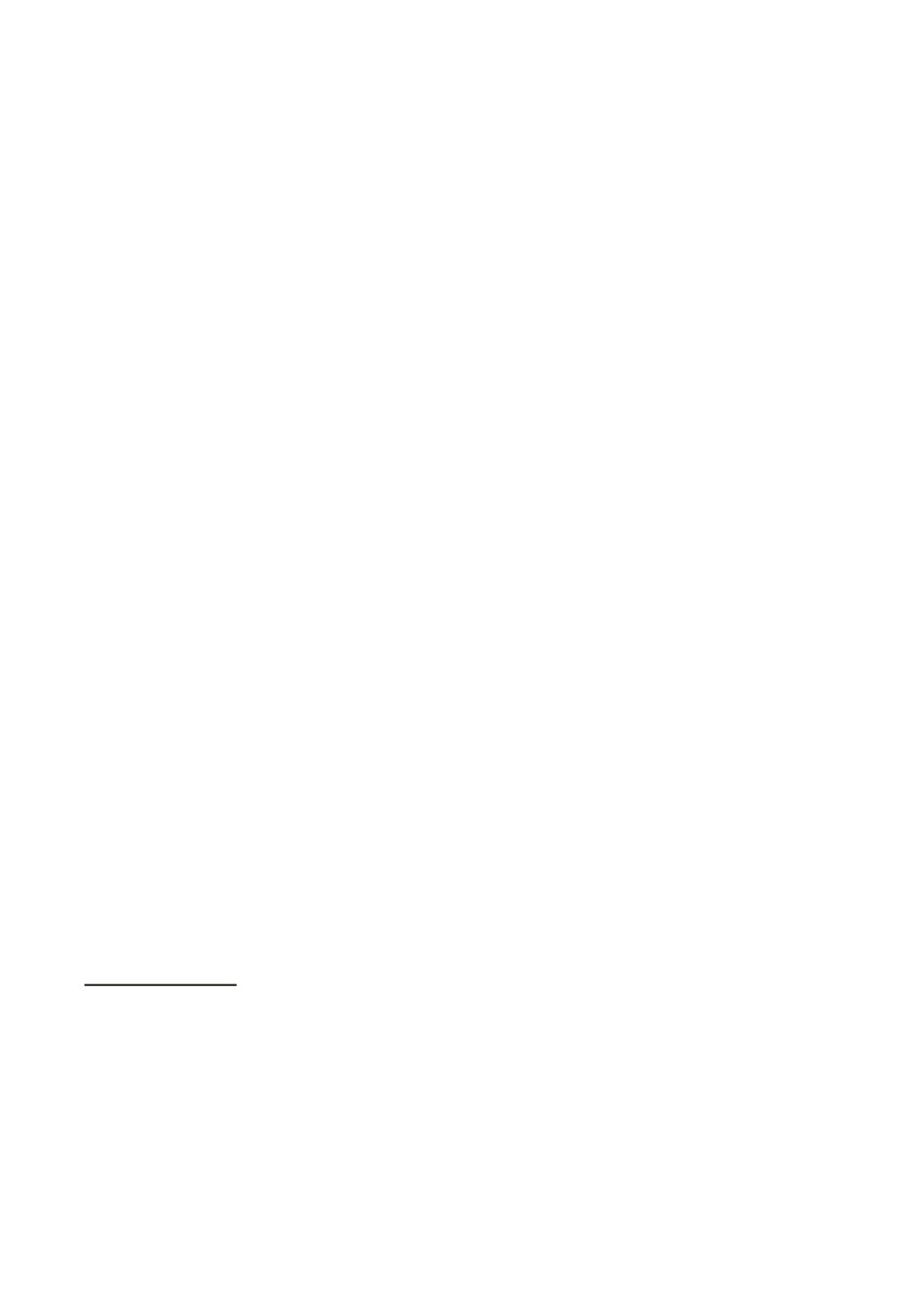
474
dem Ideal hoher Liebe und Polyphems ungelenken Versuchen, seine Liebe auszu-
drücken. Dieser verharrt, die zarte Geliebte preisend, bei Vergleichsmöglichkeiten
aus seinem Lebensbereich. Er lobt sie: „Weiße Galateia, warum stößt du den Lieb-
haber aber von dir, Geliebte, weißer als Quark anzuschauen, zarter als ein Lamm,
munterer als ein Kalb, glatter als eine unreife Traube?“
30
In komischer Verkennung
ihrer anderen Wesensart wirbt er mit seinem Reichtum: mit Schafen, Milch, Käse.
Als Vorbild für Vossens ‚Junkeridylle‘
31
kommen „Das Ständchen“ und „Der Ky-
klop“ Theokrits in Frage. Satire erniedrigt ihre Gegenstände, indem sie diese der
Lächerlichkeit preisgibt, evident werdend auch im literarischen Namen: Junker
Wenzel von Schmurlach auf Schmurlachsbüttel und Hunzau wirbt um die schöne
Tochter des hiesigen Försters mit einem Ständchen, nachdemVater und Brüder des
Mädchens zur Otternjagd aufgebrochen sind. Auch hier die Figur des zur Karika-
tur verzerrten, sich maßlos überschätzenden Liebhabers: Junker Wenzel hinkt und
hat einen doppelten Höcker. Wie Polyphem (11. Eidyllion, „Der Kyklop“) brüstet
er sich in komischer Selbstüberhebung mit Erfolgen im Liebesspiel.
32
Vossens
Idylle zielt freilich auf mehr. Voß belässt es nicht dabei, eine Schäferwelt durch
eine Jägerwelt zu ersetzen, wo die Geliebte dann statt mit Quark mit einem eng-
lischen Windspiel verglichen wird. Während Polyphem und die Meeresnymphe
Galateia bei Theokrit Gestalten aus der Mythologie blieben, öffnet Voss mytho-
logische Motive zeitkritisch. Er weitet den Blick über die Grenzen des Hofes auf
die ländliche Wirklichkeit zwischen (adligem) Gutshof und Dorf und beleuchtet
dabei die Verflechtung der sozialen Verhältnisse auf dem Lande, indem er neben
dem Junker auch Hofmeister, Dorfpfarrer und Bauern in seiner Idylle auftauchen
lässt. Bei den Bauern ist es nicht weit her mit der Befolgung der göttlichen Gebote,
sie entheiligen den Sonntag, dies unter der Obhut eines Pfarrers, der sich ins Grab
trinkt. Schwerer jedoch als diese Satire auf die dörfliche Realität wiegt die Aus-
sage, die Voß in das Motiv des Liebeswerbens integriert. Im 11. Eidyllion sucht
Polyphem seiner Geliebten das Leben an seiner Seite schmackhaft zu machen,
indem er mit seinem Besitz an Schafen und Ziegen prahlt.
33
Der ungestalte Junker
bietet seinem Fiekchen hingegen an, zunächst ein Kammermädchen bei seiner
Mutter zu werden und zugleich auch seine Geliebte. Später will er sie mit seinem
Hofmeister, einem Theologiestudenten, verheiraten, der als Nachfolger des bishe-
rigen Pfarrers in ihrer „Schürze die Pfarre“
34
bekommt.
30
Theokrit: [Der Kyklop], in: Theokrit: Gedichte, S. 89.
31
Die 1777 entstandene und zuerst im Hamburger Musenalmanach für das Jahr 1778 veröffentlichte
Idylle „Das Ständchen“ ist eine von Vossens Anti-Idyllen, die Voß im Untertitel der Erstfassung
nach der Figur ihres Protagonisten als eine ‚Junkeridylle‘ bezeichnet.
32
Vgl. Theokrit: [Der Kyklop], in: Theokrit. Gedichte, S. 91; auch in: [Das Ständchen], S. 35.
33
Vgl. Theokrit: [Der Kyklop], ebd., S. 89 u. 91.
34
Voß: Das Ständchen, in: August Sauer: Johann Heinrich Voß, Stuttgart 1886, S. 110.









