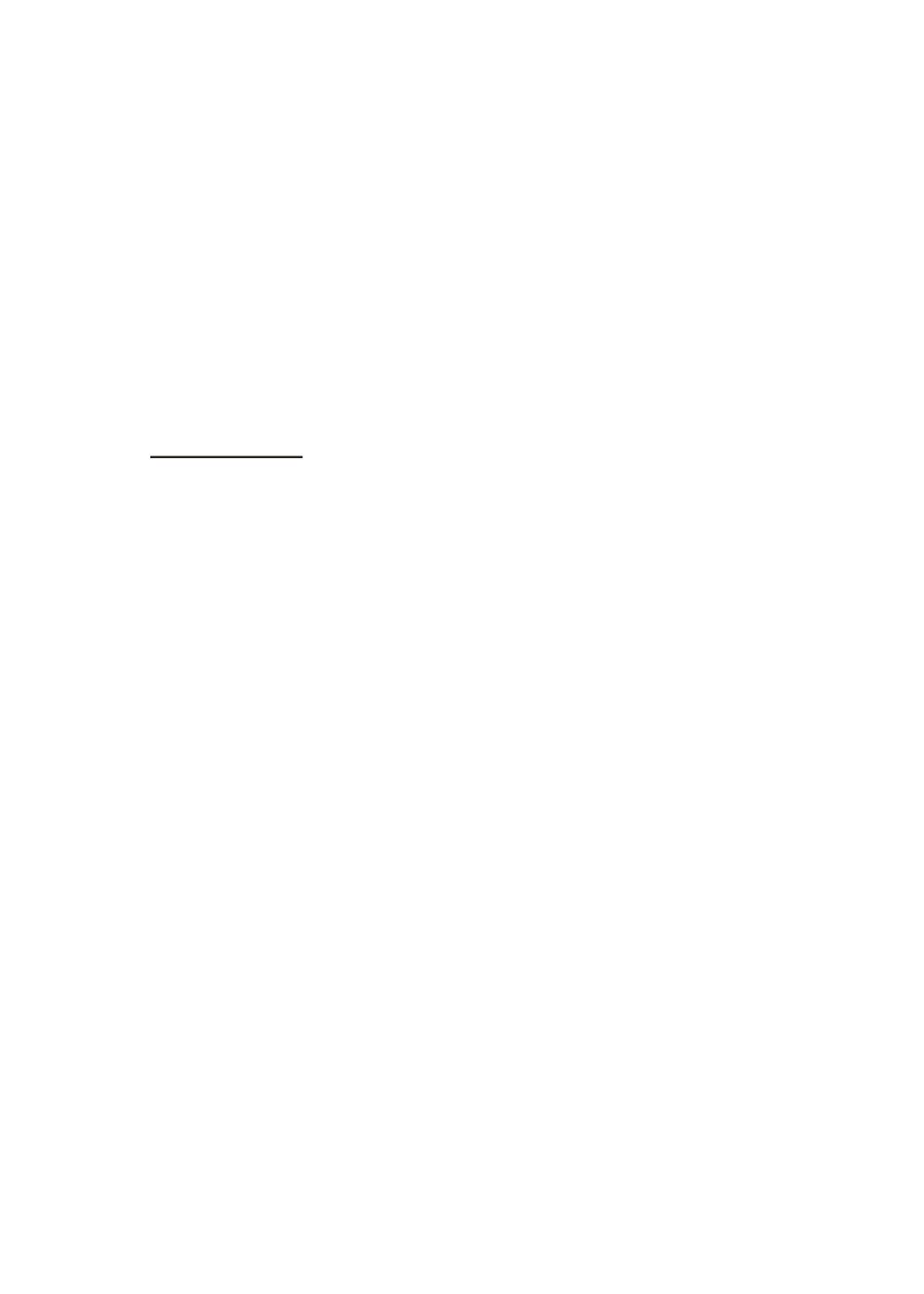
471
die Bildungswege deutscher Pfarrer aufklärungsoffene Positionen durchzusetzen.
23
Vossens Studienzeit in Göttingen ist in der Bibliothek am Lesescreen erschließbar,
auf den wir an dieser Stelle mit unserem Lupen-Piktogramm verweisen.
24
Bald
aber löst die Lese- und Übersetzungsversenkung in die homerische Welt die Ger-
manenbegeisterung der Göttinger Zeit ab. Als Voß endlich durch Unterstützung
junger Dichter die Universität Göttingen beziehen kann, gibt er sein Theologie-
studium Ostern 1773 auf, um sich fortab dem griechischen Altertum zu widmen.
Auch hier aufklärerisches Widerstreben gegen alte Satzungen: „Und was sind
die Theologen unruhige Leute, wenn einer selbst denken will“.
25
Voß bezeichnet
ebenda die Theologie als dunkel, während er mit Helle das aufzunehmende Stu-
dium der Philologie, der antiken Sprachen und Literaturen, bedenkt. Ihm war die
rhetorische Grundspannung von Dunkelheit und Licht, auf die sich die gesamte
Aufklärung bezog, vertraut.
23
Theologische Bildungsberufe waren ein Standortfaktor für die Aufklärung in Deutschland. In der
Wirkung des zwanzig Jahre älteren Dichterpfarrers Brückner auf Voß zeigt sich die Bedeutung
des protestantischen Pfarrhauses gerade in den deutschen Verhältnissen. Voss hatte von Brückner
empfangene Anregungen sowie dessen Freundschaft lebenslang hoch geschätzt. Brückner stammte
aus der namhaften mecklenburgischen Pastorenfamilie Trendelenburg, verbunden mit Neustrelitz
und Neubrandenburg. Er besuchte das Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin und studierte im
Rahmen einer berufsbezogenen Laufbahn an der um Aufklärungspositionen ringenden Universität
Halle (1765-67); er war ab 1771 Prediger in Groß Vielen und ab 1789 Prediger und Hauptpastor im
Mecklenburg. Brückner wurde 1798 von Caspar David Friedrich, mit dem er familiär verbunden
war, gezeichnet. Zu Brückners Dramen, patriarchalischen Idyllen und Kinderidyllen gibt es keinen
Forschungsstand, doch eine neuere kleine Studie von Małgorzata Kubisiak: „Soll’t ich Kinder zum
Unterrichte bekommen, so werden Ihre Idyllen [...] mir zu einer großen Erleichterung dienen.“
Zu Erst Theodor Johann Brückners idyllischem Werk. In: Maria Katarzyna Lasatowicz, Andrea
Rudolph (Hg.): Corpora und Canones, Quellen und Forschungen, Berlin 2013, S. 13-26. Deren
Ergebnisse sind auch in schulischer Kooperation nutzbar. Siehe die von Andrea Rudolph beschrie-
benen Schulprojekte.
24
Es geht um den Göttinger Hain. Der Besucher kann nachlesen: Den Stürmern und Drängern er-
schien das Germanentum als politische Gegenwelt und Nationalerinnerung. Der damals auch von
Voß bewunderte Dichter Klopstock stellte in seinem Gedicht „Der Hügel und der Hain“ die Frage:
„Ist Achäa der Thuiskone Vaterland“, die er unter Rückgriff auf die „Germania“ des Tacitus (98
n. Chr.) so beantwortete: „Des Hügels Quell ertönt von Zeus,/ Von Wodan der Quell des Hains./
Weck‘ ich aus dem alten Untergange Götter/ Zu Gemählden des fabelhaften Liedes auf, /So haben
die in Teutoniens Hain/ Edlere Züge für mich!“ Voß nutzt das von ihm zunächst mit ‚Germanien‘
besetzte Bild des Goldenen Zeitalters – das Bild vom imaginativen Urzustand des menschlichen
Geschlechts - zur Vorwegnahme einer Zukunft. In einem frühen Brief an Friedrich Leopold Stol-
berg vom 29. Dezember 1773 aus Göttingen gibt Voß der Hoffnung Ausdruck, dass die Mitglieder
des Bundes bei der Errichtung des Goldenen Zeitalters hier auf Erden mithelfen: „Glaubt Gersten-
berg, daß wir das unsrige zum goldnen Zeitalter mit beytragen werden? Das macht stolz! Aber
weh uns! weh! weh! uns! wo wir der Hoffnung nicht entsprechen. („J. H. Voß an F. L. Stolberg,
29.12.1773, Göttingen, in: Jürgen Behrens: Johann Heinrich Voss und Friedrich Leopold Graf zu
Stolberg. Neun bisher unveröffentlichte Briefe, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, hg.
von Detlev Lüders, Tübingen 1965, S. 59).
25
Brief vom 13. Juni 1773 an Ernst Theodor Brückner, zit. nach Wilhelm Herbst, S. 66.









