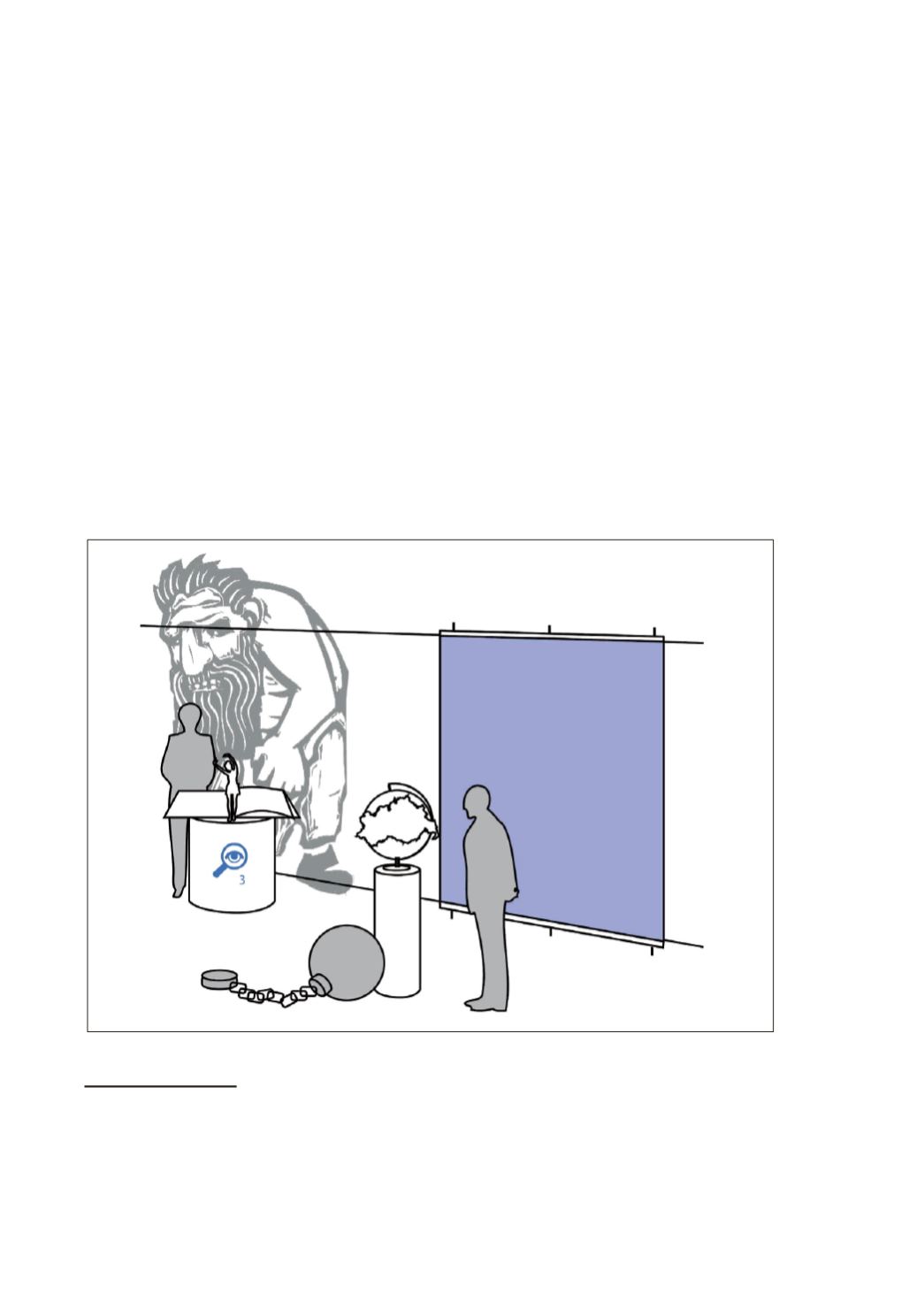
472
Kabinett 3:
Auf gegenwärtigem heimischen Boden: Gedichtete Sozialkritik
Ausstellungsdidaktische Schwierigkeiten sollen nicht verschwiegen werden.
Dichterische Formen wie Epos und Idylle, die sich noch im ausklingenden 19.
Jh. einiger Beliebtheit erfreuten
26
, sind heute passé. Die Dichtungen von Voß,
für ein Voß-Verständnis und das der Epoche unverzichtbar, sind im kulturellen
Bildungswissen eines durchschnittlichen Besuchers so gut wie nicht mehr vor-
handen. Optische Anreize, die eine Oberflächenspannung aufweisen, müssen für
die Dichtungen interessieren. Sie deuten das Miteinander von antik
und
volkskul-
turell codierten Bildfeldern in Vossens Dichtungen an. Zwei flächenhaft ausge-
führte Wandbilder in Überlebensgröße zeigen eine kyklopische Riesenfigur – eine
Anspielung auf Vossens komische junkerkritische Idylle „Das Ständchen“ (1777)
– und einen schwarzen Schattenriss – eine Anspielung auf den zur Teufelsfigur
gemachten adligen Jäger in Vossens tragischer junkerkritischer Idylle „Die Pfer-
deknechte“ (1775). Die Anordnung bezieht tragische und komische Idylle kontra-
punktisch aufeinander.
26
Zur Bedeutung dieser Formen noch im 19. Jahrhundert siehe Heidi Ritter: Resonanz und Popularität
der „Luise“ im 19. Jahrhundert. In: Andrea Rudolph (Hg.): Johann Heinrich Voß, S. 215-236.
Abb. 4 – Globus









