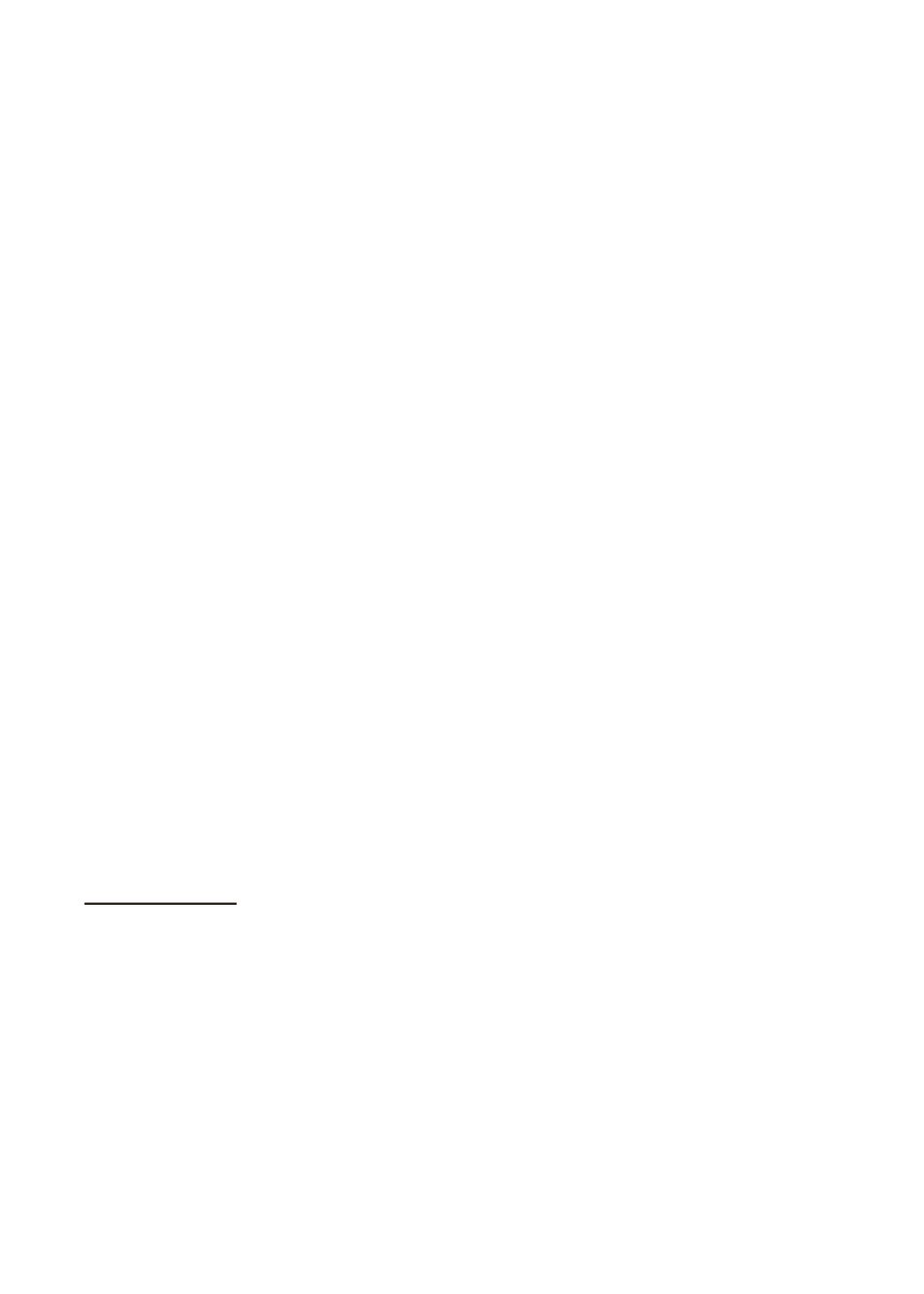
366
Er bemerkt weiter, dass er an Ausgrabungen selbst keinen Anteil hat und fühlt sich
als „Garbenbinder“ hinter den „Schnittern“.
21
Es ist hier weder angebracht, noch fehlt der Raum, ausführlich über das Werk zu
berichten oder einen genauen Vergleich beider Auflagen durchzuführen. Dazu sei
nur gesagt, dass die Neuauflage rund 40 Seiten mehr umfasst und Kapitel teilwei-
se neue Überschriften erhielten. Meine Absicht soll es sein, auf bemerkenswerte
Formulierungen hinzuweisen und bei diesem oder jenem die Lust zu wecken, das
Buch wieder bzw. überhaupt einmal in die Hand zu nehmen, da es mir für jeden,
der sich mit Archäologie und Archäologen im 19. Jahrhundert beschäftigt, unent-
behrlich zu sein scheint.
Bereits im ersten Kapitel („Unsere Kenntnis antiker Kunstwerke bis zum Schlusse
des achtzehnten Jahrhunderts“, S. 1-12)
22
setzt der Autor mit seiner Bemerkung,
dass die Archäologie zu den „Eroberungswissenschaften“ des 19. Jahrhunderts
gehört, ein Ausrufezeichen. Von dem militärisch angehauchtem Begriff einmal
abgesehen, wer könnte es leugnen, dass in jenem Jahrhundert und nach der Grün-
dung eines unabhängigen griechischen Staats, die Kenntnisse besonders über das
klassische Altertum und dessen Vorzeit geradezu explodierten (um einmal im Bil-
de zu bleiben)? Vieles war neu, vieles bedurfte eines Lernprozesses. Zwar hat-
te schon ein Jahrhundert zuvor Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) die
Grundlagen für die Beurteilung der griechischen Kunst gelegt, doch kannte er
deren Werke meist nur aus römischen Kopien. Bedeutende Funde, Entdeckungen
und Sammlungen, die vor dem 19. Jahrhundert gemacht wurden bzw. entstanden
sind, werden aufgezählt
23
und im zweiten Kapitel („Die napoleonische Zeit“, S.
13-24) auch auf den Stein von Rosette hingewiesen, der so wichtig bei der Entzif-
ferung der ägyptischen Hieroglyphen war.
Durch „die Wiedergewinnung Griechenlands“, so die Überschrift zum dritten
Kapitel (S. 25-51), wurden Winckelmanns Ansichten überprüf- und korrigierbar.
Zweifellos interessant ist die Beurteilung von Adolf Michaelis – und wohl nur aus
21
Michaelis 1906, S. V: „Die Blätter zu veröffentlichen haben mich teils mannigfache Wünsche aus
dem Kreise der Zuhörer, teils der auffallend Umstand veranlaßt, daß der anziehende Gegenstand
noch keine zusammenfassende Schilderung gefunden hat. In diese Lücke einzutreten schien mir die
Aufgabe eines Archäologen zu sein, der an den Ausgrabungen keinen eigenen Anteil hat nehmen
können, aber seit einem halben Jahrhundert diese Unternehmungen aus der Ferne gefolgt ist und
auch darüber hinaus noch einige unmittelbare Kunde hat gewinnen können. Hinter den Schnittern
muß auch der Garbenbinder seines bescheidenen Amtes walten.“
22
Die Kapitelüberschriften und Seitenangaben beziehen sich auf die erste Auflage des Buches: Mi-
chaelis 1906.
23
Sammlungen römischer Päpste und Kardinäle (Ludovisi u. a.), Entdeckungen in Herculaneum,
Pompeji oder in Sizilien.









