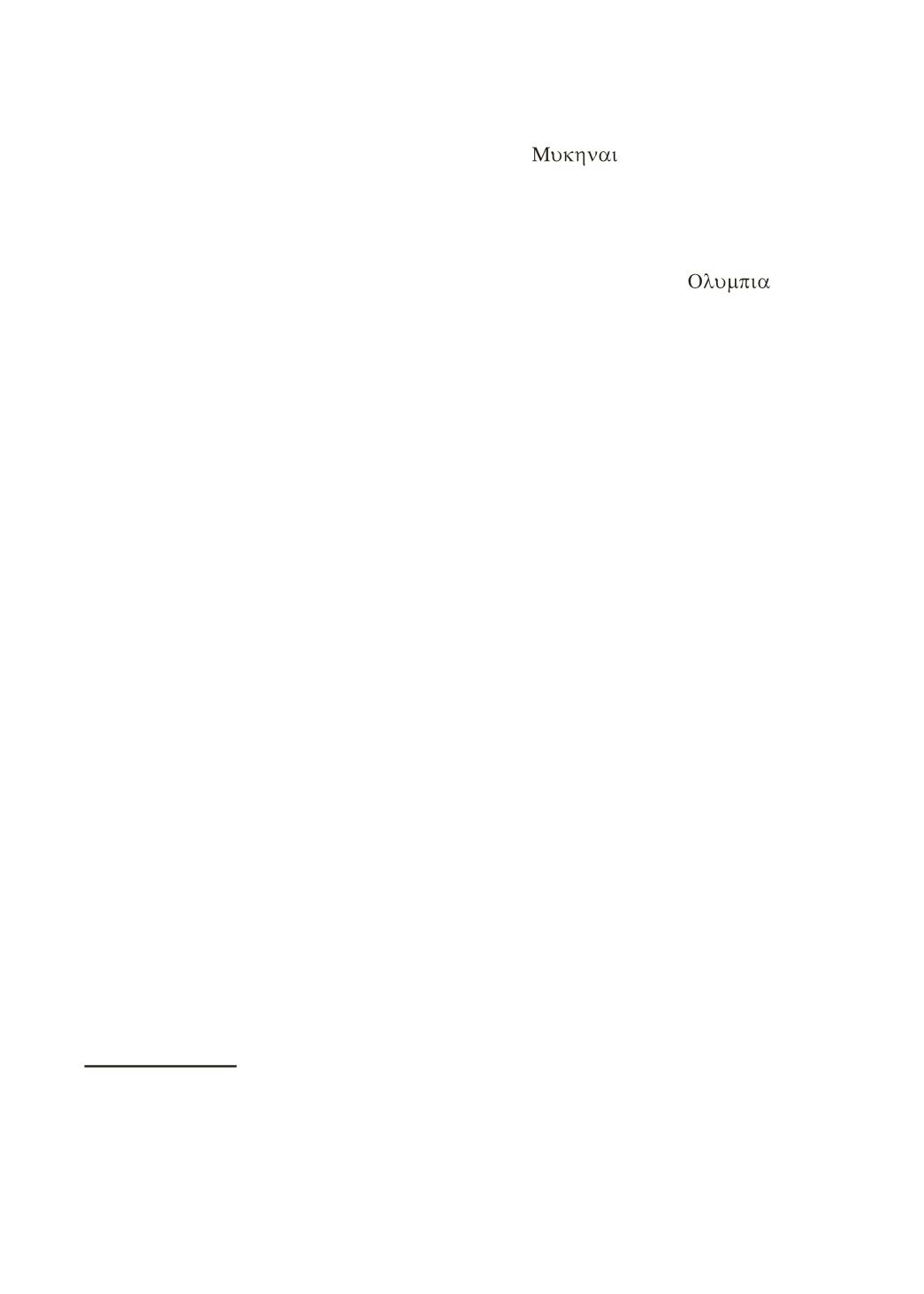
370
mer womit ich jetzt (mehrere) Säle füllen könnte, auch den Schatz u den in Troja
gefundenen Triglyphenblock als Waffe gegen das griechische Gouvernement zu
brauchen um die Erlaubniß zu haben Olympia und
auszugraben. Ich
versprach Alles bis jetzt gefundene u Alles was ich in jenen 2 Orten finden wür-
de der gr(iechischen) Nation zu vermachen auch ein Museum zu bauen für nicht
weniger als 200/m franken. Mein Vorschlag wurde im Parlament mit Jubel ein-
stimmig angenommen, aber das Ministerium ist gegen mich, auch erzeugen mei-
ne Erfolge hier bei der archaeol Gesellschaft furchtbaren Neid so daß
jedenfalls an die preuß Regierung, die darum ebenfalls eingekommen ist zumAus-
graben überlassen wird. Man will mir nur Mykene geben u dafür gebe ich die
Kunstschätze nicht her, fühle mich auch gekränkt u will hier gar nicht graben.“
31
Zweifellos das interessanteste Kapitel für einen Mykenologen und Schliemannfor-
scher ist das achte Kapitel: „Prähistorie und griechische Vorzeit“ (S. 175-199). In
der Untersuchung dieser Epoche wurde ganz besonders im 19. Jahrhundert Neu-
land betreten, war doch die Grenze für die Anfänge der griechischen Kunst im 7.
Jh. v. Chr. festgelegt. Mit der Entdeckung des geometrischen und Dipylon-Stils
wurde diese Grenze schon brüchig. Doch zu wenig war über die Prähistorie, „ein
übel gebildeter Name“.
32
, wie Michaelis meinte, dem nur beizupflichten ist, be-
kannt, obwohl schon Christian Jürgen Thomsen (1788-1865) im Jahre 1832 für
den Norden von einem „Drei-Periodensystem“ sprach, dass mit Sicherheit auch
für andre Gebiete zu gelten hatte, wie Höhlenfunde in Frankreich, Pfahlbauten in
der Schweiz und das Gräberfeld in Hallstatt bewiesen.
„Während sich so der Ausblick ins Unermeßliche erweiterte“, so führt Michaelis
an, „und früher ungeahnte Fäden die griechische Kunstübung rückwärts mit der
des übrigen Europas zu verknüpfen schienen, trat auf dem griechischen Gebie-
te selbst etwas Neues ein. Ich spreche von
Heinrich Schliemann
, dessen Name
eine ganze Epoche bezeichnet.“ Und weiter: „Noch ist der Kampf um Schliemann
nicht ganz zur Ruhe gekommen. Sind auch die Stimmen derer, die sich anfangs
ganz ablehnend gegen ihn verhielten, längst verstummt, so erschallen doch noch
immer gelegentlich, besonders von Seiten derer die archäologischer Wissenschaft
fernstehen, Jubelhymnen, die in blinder Vergötterung in Schliemann das Ideal ei-
nes Forschers feiern. Man wird heutzutage seine Verdienste und Mängel, so weit
diese der Wissenschaft fühlbar geworden sind, ruhig gegeneinander abwägen und
ein unparteiisches Urteil fällen können, der Zustimmung wenigstens derer sicher,
denen ein wissenschaftliches Urteil über archäologische Fragen zusteht.“
33
31
Buchholz 1995, S. 26; Witte 2001.
32
Michaelis 1906, S. 177.
33
Michaelis 1906, S. 182.









