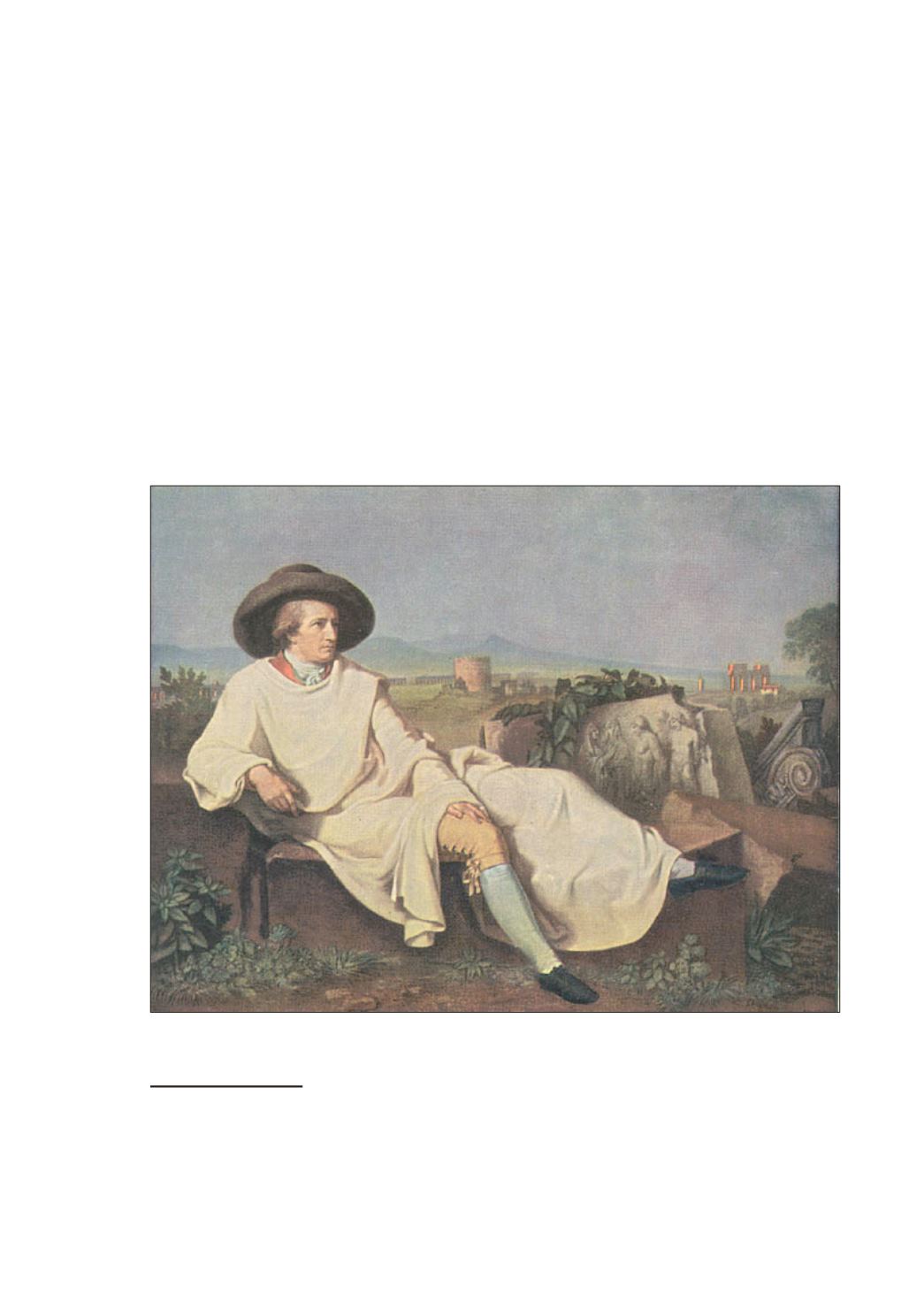
367
seiner Zeit zu verstehen – über das Handeln des britischen Botschafters in Kon-
stantinopel Lord Elgin (1766-1841). Bekanntlich hatte er sich 1801 einen günstigen
Ferman verschafft, der ihm erlaubte, auch figürliche Teile vom Parthenon zu ent-
fernen. Michaelis geht der Frage nach, ob Elgins Handeln rechtens war und kommt
zu dem Schluss: „Wir haben hier nur zu fragen, ob durch Lord Elgins Vorgehen
die Wissenschaft benachteiligt oder gefördert worden ist, und da kann die Antwort
nicht zweifelhaft sein.“
24
Dadurch wurde nämlich die Betrachtung und Förderung
der griechischen Kunstgeschichte zumindest 50 Jahre früher erreicht. Diese Aussa-
ge stößt freilich seit langem auf Widerspruch
25
, möchte doch die griechische Seite
die „Elgin Marbles“ im neu errichteten Akropolis-Museum präsentieren.
Aber damals schwärmten viele, Michaelis schreibt „alle“, von diesen Athener An-
tiken. Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832; Abb. 8) pries sich glück-
lich, diese auf Zeichnungen noch gesehen zu haben. Und Michaelis betont: „Eine
vollkommene Revolution des Geschmackes vollzog sich; das Land der Griechen,
24
Michaelis 1906, S. 29.
25
Es heißt auch oft: quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti!
Abb. 8 – Johann Wolfgang von Goethe in der Campagna (Gemälde von Tischbein, 1787)









