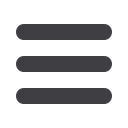33
Athene gab sie ihrem Schützling schnellstens zurück. Mehr noch, im Gegen-
schlag zertrümmerte die Göttin dem anderen das Joch des Gespanns. Eumelos
kam, wie zu erwarten, nach allen anderen ins Ziel, den Wagen selbst ziehend und
die Pferde vor sich hertreibend. „Unser bester Mann treibt als letzter die einhu-
figen Rosse heran“, kommentierte Achill das Bild. „So kommt denn! Wir wollen
ihm doch einen Preis geben – das fordert der Anstand –, und zwar den zweiten.“
Achills großmütige Absicht stieß jedoch bei Antilochos auf Widerspruch, der sich
soeben diesen zweiten Preis auf fragwürdige Weise „erkämpft“ hatte. Das jedoch
rief den geprellten Menelaos auf den Plan, der nun kein Blatt vor den Mund nahm
und von Antilochos verlangte, er solle beschwören, ihn nicht beim Wettkampf
listig behindert zu haben. Daraufhin lenkte Antilochos ein, verwies auf seine
Jugend und übergab die als Preis ausgesetzte Stute dem Menelaos, die er von
dem so Besänftigten schließlich wieder zurückerhielt. Da Menelaos seine Ehre
wiederhergestellt sah, beschied er sich hochherzig mit dem dritten Preis.
Spätesten hier ist zu fragen, ob es sich bei solch geschildertem Wettkampf um
einen wirklichen Agon oder vielleicht nur um eine Parodie handelte? Immerhin,
es wurde betrogen, manipuliert und um die Preisverteilung gestritten, und es
bleibt prima vista der Eindruck einer gleichsam großen Regelwidrigkeit. Aber
jeder Zweifel verbietet sich, wenn man an Homer, dem jedes Augenzwinkern
fern lag, und an den Charakter des Epos denkt. Was sich hinter der scheinbar
parodiehaften Dramatik des von Achill veranstalteten Wagenrennens verbirgt,
sind der komplizierte innere Mechanismus eines Agons und sein durchaus span-
nungsgeladenes sozial-psychologisches Umfeld. Nicht um eine Persiflage, nicht
um eine mögliche groteske Tragik des Agon ging es, sondern der Dichter mach-
te deutlich, welche Gefahr tragisch-dramatischer Entartung einem gymnischen
Agon droht, der dann auch aufhört, ein Spiel zu sein, wenn offenbar bestehende
Abmachungen, wenn ein vorher bestimmter und geltender Konsens nicht einge-
halten werden.
Ein sportlicher Wettkampf, wie jedes Spiel mit zwei und mehr Personen, ist, soll
das Spiel funktionieren, an ein vereinbartes und einzuhaltendes Regelwerk ge-
bunden. Das Regelwerk allein bliebe wirkungslos, wenn nicht seitens der Wett-
kampfteilnehmer - als einer weiteren Voraussetzung - die geforderte notwendige
Fairness aufgebracht würde, die wiederum in der moralischen Integrität und auch
im ethischen Bewusstsein der Teilnehmer wurzelte, das entsprechend entwickelt
sein musste. Es war letztlich dieser verhältnismäßig breite Grundkonsens, be-
stehend aus prozeduralen Regeln und ihrer Akzeptanz, aus Unterordnung und
ethisch-moralischer Reife, der einen Agon erst möglich machte. Dieser Konsens,
der ein übergreifender und damit auch ein gesellschaftlicher war, schloss zwangs-
läufig das Element der Kontrolle ein, dann nämlich, wenn es um die konkreten