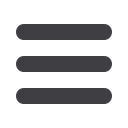38
Fünftens, der Spieleinsatz beim gymnischen, hippischen oder musischen Agon
war in Abhängigkeit vom jeweils konkreten Fall ein körperlich-gesundheitlicher,
ideeller und materieller, der Zweck – neben dem ideellen Prestigegewinn wohl
immer auch – unmittel- oder mittelbar – ein materieller. Im Agon standen sich
sechstens nicht entweder nur Körper oder nur Geist gegenüber. Auch im die Phy-
sis ganz fordernden sportlichen/kampfsportlichen Agon war anfangs immer auch
ein –
cum grano salis
– Teil von Vernunft, von Geisteshaltung präsent, der dann
unter dem Druck des berufsmäßigen Athletentums zunehmend kleiner und ir-
relevant wurde. Bei künstlerisch-musischen oder politischen Agonen spielte die
Physis der Darsteller oder Vortragenden ebenfalls eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Die Agone der griechischen Frühzeit, siebtens, zeichneten sich im Hin-
blick auf den Teilnehmerkreis und das Publikum durch eine gewisse exklusive
korporative Enge aus, doch tendierten die Agone später, so wie das agonale Prin-
zip immer mehr Lebensbereiche überlagerte und durchdrang, zu einer stärkeren
demokratischen Öffnung.
IV.
Verlassen wir nun den spielerischen Agon, um uns – auch diesmal wieder – mit
Homer der agonalen Wirklichkeit zuzuwenden. Vor Troias Mauern stellen sich
endlich die zwei tapfersten Protagonisten der beiden Kriegsparteien gegenein-
ander. Es geht um ein Kräftemessen, dessen Einsatz das Leben des einen der
Kontrahenten und dessen Ziel die Schwächung der einen, der trojanischen, bzw.
die Stärkung der anderen, der achäischen Seite ist. Hektor, der kurzzeitig über ein
Friedensangebot nachgedacht hatte, leiten Ehr- und Pflichtgefühl, konventionel-
les Herkommen und schlichter, aus dem Kriegsverlauf resultierender Handlungs-
zwang.
32
Achills Motiv ist in erster Linie dem Wunsch geschuldet, Rache für
Patroklos‘ Tod zu üben. Die Pflicht, für die Achäer einstehen zu müssen, kommt
sekundär hinzu.
Der Laufagon brachte keine Entscheidung, „denn Achill konnte Hektor im Lau-
fe nicht einholen und dieser ihm nicht entrinnen“ (Il. 22, 199). Diese Pattsitua-
tion lösten die Götter. Hektor, nach dem Agon mit der Lanze erkennend, dass
ihm nach dem Verlust eben dieser Waffe der Tod vorbestimmt war, griff zum
Schwert, weil er im Kampfe ruhmvoll untergehen wollte. Der Agon verlor damit
seine Gleichgewichtigkeit, denn Hektors Schwert und Achills weittragende Lan-
32
E. Stein-Hölkeskamp, a. a. O., S. 31f. bezeichnet Hektor „als die große ‚patriotische’ Ausnahme“,
dessen Verantwortung für die Gemeinschaft ein entscheidendes Motiv seines kämpferischen
Einsatzes war.