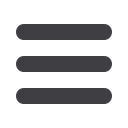28
reich menschlicher Existenz eingesenkt. Die jüngere, die negative Form der Eris
wurde, personifiziert als Schwester und Gefährtin des Ares, zur Urheberin von
Kampf und Streit, zum Sinnbild für Zank, Zwietracht und – als „Ausartung ins
Große“ – des Krieges.
4
„Die Hülle und Fülle des Agonalen“, um noch einmal Burckhardt heranzuziehen,
„findet sich als üblich und selbstverständlich bei Homer“.
5
Die „Ilias“ selbst, als
Ganzes betrachtet und bezogen auf den Troianischen Krieg, ist nichts anderes als
die Darstellung eines gewaltigen militärischen Gruppenagons.
6
Zwar schrumpft
die zehnjährige Auseinandersetzung im neunten/zehnten Jahr des Krieges auf
nur 51 Tage des Kampfgeschehens, aber der Eindruck der Großartigkeit des
Kampfes, nicht eines Kampfspieles, sondern Krieges mit all seinen Grausam-
keiten, bleibt bestehen. Dennoch, es war nicht der Troianische Krieg, der den
Dichter vordergründig beschäftigte. Es war vielmehr der Groll des Achill, dessen
gleichfalls agonale Auseinandersetzung mit Agamemnon, die der Dichter zum
zentralen Gegenstand seines Vortrages machte. Hinzu trat noch – sofort mit dem
Beginn der „Ilias“ - jene dritte und treibende Kraft, welche das Handeln der bei-
den Protagonisten und das Schicksal Troias vorbestimmte: die Götter mit ihrem
unter sich geführten Agon, bezogen immer auf die Gefechte und Zweikämpfe der
Menschen vor Troias Mauern. „Den Zorn des Peliden Achilleus besinge, Göttin,
den verfluchten Zorn! Er brachte den Achaiern eine Unzahl von Qualen, viele
tapfere Heldenseelen warf er dem Hades vor, ihre Leiber machte er den Hun-
den zum Fraß; so erfüllte sich der Wille des Zeus. Beginne das Lied mit dem
Ursprung des Zorns, als es im Streit erstmals zum Bruch kam zwischen dem
Atriden, dem Feldherrn des Heeres, und dem göttlichen Achilleus! Wer von den
Göttern hetzte die beiden im Streit aufeinander zum Kampf?“ So lauten die ers-
ten Verse der „Ilias“ (Il. 1, 1-9).
7
I.
Bereits Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf hatte klar erkannt, dass nicht der
Troianische Krieg das zentrale Thema der „Ilias“ war, sondern Achill: Achill
4
J. Burckhardt, GK 4, S. 93f.
5
Ebenda, S. 90.
6
Ch. Meier, Kultur um der Freiheit willen, S. 112: „Insofern tragen die Helden einen Agon
aus, einen Wettstreit. In ihm muß sich ihre aretē, ihre Bestheit erweisen – nicht zuletzt vor der
Nachwelt. Einer mißt sich am anderen. Griechen gegen Trojaner und die Helden unter sich“.
7
Bei deutschen Homerzitaten verwende ich nicht die Voßsche Homerübersetzung der „Ilias“, son-
dern halte mich an die verständlichere und genauere Prosaübersetzung von Gerhard Scheibner:
Homer, Ilias, Bd. 1 - 2, in Prosa übertragen von G. Scheibner, Berlin/Weimar 1972