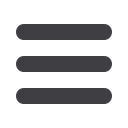39
ze waren inkommensurable Waffen. Aus dem Agon wurde Mord. Mehr noch,
Hektors Tod folgte der Exzess des Siegers, der sich über jeden Moralkonsens
hinwegsetzte, die Schändung des toten Feindes duldete, ja diese Schändung bis
zur Perversität steigerte: „Hinten an beiden Füssen durchbohrte er ihm von der
Ferse bis zum Knöchel die Sehnen, knüpfte lederne Riemen darum, band sie
am Wagenkorb fest und ließ sein Haupt hinterherschleifen“ (Il. 22, 395 - 398).
Der Agon zwischen Achill und Hektor, auf Leben und Tod geführt, bot keinen
Spielraum für einen Kompromiss. Es musste geschehen, was nicht anders ablau-
fen konnte, denn die Götter wollten es so. Achills Rachelust machte jede Ver-
ständigung unmöglich und konnte – wie jede gewollte Rache überhaupt – nicht
Grundlage eines wirklichen Agons sein. Der Zweikampf von Achill und Hektor
in seiner Endphase hatte zudem noch eine klare, in die Zukunft weisende Dimen-
sion. In ihrer Maßlosigkeit musste Achills Rache abschrecken, denn sie verletzte
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Sie war weder dem Anlass des Krieges
adäquat, noch ließ sie sich durch den Tod des Patroklos rechtfertigen. Achills Art
der Rache war kein brauchbares Mittel der Konfliktlösung. Sie stand außerhalb
jeder Rationalität von Vergeltung und war in ihrer schrecklichen Grausamkeit
vom Dichter wohl als Menetekel und Warnung gedacht worden.
V.
Ich kehre zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen zurück. Das Agonale ent-
wickelte sich zur „zweiten Triebkraft“ antiken Griechentums, wie Jakob Burck-
hardt bemerkte. Es will tatsächlich so scheinen, als sei mit dem agonalen Prin-
zip jenes subjektive Agens entdeckt, das die antik-griechische Gesellschaft ganz
wesentlich von der altorientalischen und der barbarischen unterschied, wie bei
Lukian im fiktiven Dialog Solons mit dem Skythen Anacharis deutlich wird,
und das ihr soviel Beweglichkeit und Flexibilität verlieh, das über das Mittelalter
(Rittertum, städtisches Patriziat, feudale Lebensweise)
33
von der westeuropäi-
schen bürgerlichen Gesellschaft ererbt wurde und seither einen ihrer entschei-
denden Charakterzüge ausmacht und ihre Besonderheit nach Ost wie Süd bedingt
(eine Ausnahme bildet offenbar Japan mit seiner Samurai-Ideologie und deren
dortigen Nachwirkungen). Ob uns aber das Streben nach immer besserer, immer
höherer Leistung, das Wollen von immer mehr, ob uns diese agonalen Denk- und
33
In diesem Zusammenhang muss an A. J. Gurjewitsch, Das Individuum im europäischen
Mittelalter, Müchen 1994 erinnert werden. Gurjewitsch verweist in diesem Buch auch auf die
Linien, die, trotz Brüchen, von der Antike her in das „geistige Universum“ des mittelalterli-
chen Menschen hineinreichten. Das mittelalterliche Individuum war wie in der Antike nicht
ohne seine soziale Gruppenbindung denkbar, und erst in der Gruppe gelang es ihm, sich als
Persönlichkeit zu erkennen und zu entwickeln.