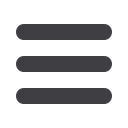31
lenko, der gegenwärtig an einer Monographie über den „indoarischen Achilles“
arbeitet, hält ihn hingegen für vorhomerisch. Der Achilleskult bzw. der Achilles-
Mythos habe seinen Ausgangspunkt in Griechenland und sei als immanenter Be-
standteil der griechischen Kolonisationsschübe über die kleinasiatische Westküs-
te weiter in das nördliche Schwarzmeergebiet „gewandert“.
21
II.
Eingebettet in den Grundkonflikt der „Ilias“, d. h. die Achill-Agamemnon- und
besonders die Achill-Hektor-Kontroverse, finden sich eine Reihe jener Agone,
die zu den klassischen Komponenten griechischer Kultur zählen. Gemeint sind
vornehmlich die im 23. Gesang der „Ilias“ in aller Ausführlichkeit beschriebenen
Leichenspiele (Il. 23, 257 – 897), die Achill zu Ehren seines vor Troia gefal-
lenen Freundes Patroklos veranstalten ließ. Sie führen, wie wohl kein anderes
Literaturstück besser, in die Welt des frühen gymnischen Agons ein
22
und sie
offenbaren beim genauen Hinsehen ein über das bloße kampfsportliche Gesche-
hen hinausgehendes Beziehungsgeflecht von Agon, Regelwerk, Konvention,
von Konsens und Dissens, von Sozialstatus und Prestigedenken. Dieser homeri-
sche gymnische Agon enthält viele der später wichtigen Kampfgattungen eines
derartigen Wettstreitensembles: Wagenrennen, Faustkampf, Ringen, Wettlauf,
Scheibenwurf, Bogenschießen nach einer angebundenen Taube, Nahkampf mit
der Lanze und Speerwerfen. Wo der Ursprung solcher agonalen Leichenspiele
liegt und welche ideologischen Vorstellungen sich daran knüpften, mag dahin-
gestellt bleiben. Von Interesse sind der Agon selbst, seine Praxis, seine Funktion
und Legitimierung, „die Natur des sozialen Bandes“, wie Jean–Francois Lyotard
formulieren würde,
23
also seines sozialen Einbezogenseins, seine Wirkungsmög-
lichkeiten, Grenzen und Gefahren.
Nachdem das Grabmal für Patroklos aufgeschüttet war, rief Achill zum Agon auf
und ließ entsprechende Kampfpreise holen und ausstellen: „Kessel und Dreifüße,
Rosse, Maultiere und Stiere mit mächtigen Häuptern, schön gegürtete Weiber
und graues Eisen“. Für das zuerst stattfindende Wagenrennen, auf das ich mich
der Kürze wegen beschränken muss, waren fünf Preise ausgesetzt. Genau fünf
Teilnehmer meldeten sich: der aristokratische Thessalier Eumelos, Diomedes, der
21
V.P. Jajlenko, Indoarii – kimmerijcy – tavry (Taurier): Severnoe Pričernomor’e VIII – VII vv.
do n. e. v mifologičeskojtradicii i onomastike (= Indoarier – Kimmerier – Taurier: das nördliche
Schwarzmeergebiet des 8.-7. Jh. v. u. Z. in der mythologischen Tradition und Onomastik), in:
Carstvo Klio (= In Klios Reich), Moskau/Berlin 2011, S. 207 - 274 (Festschrift A. Jähne).
22
J. Burckhardt, a. a. O., S. 91f.; F. Kolb, a. a. O., S. 67.
23
J.-F. Lyotard, Das postmoderne Wissen, Wien 1993, S. 30ff., 42ff.