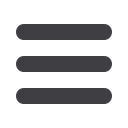29
und seine beiden Agone mit Agamemnon und Hektor. Alles Übrige war Bei-
werk. Aus diesem Grunde könnte „das Epos Achilleis heißen“, und Wilamowitz
sprach dann auch von der „Achilleis“.
8
Für den Dichter verneinte er eine genaue
Kenntnis der topographischen Gegebenheiten vor Troia/Ilios,
9
und der Krieg, den
Homer eindringlich mit allem „Schauder vor den Greueln des wilden Krieges“
schildert, war nicht der Troianische, sondern der Krieg schlechthin, der Krieg,
wie ihn der Dichter als Zeitgenosse kannte.
10
Nicht anders als Wilamowitz hält auch Joachim Latacz in seinem Buch „Troia
und Homer“ „nicht die Troia-, sondern die Achill-Geschichte für das Zentrum
der „Ilias“. „Vier Hauptakteure“ sind auszumachen: Achill, Agamemnon, Patro-
klos und Hektor. Selbst Odysseus ist nur eine Figur auf der „unteren“ Handlungs-
ebene. Der Kampf oder Krieg um Troia bildet also nur den äußeren Rahmen, die
Kulisse für die eigentliche „Achilleis“
11
und die Landschaft um Troia, wie man
– gegen Latacz - folgerichtig anerkennen muss, nur den fiktiven Handlungsraum
für die letztlich Dreierkonstellation von Achill, Agamemnon und Hektor. Diese
spannungsgeladene Dreierkonstellation wird innerhalb der 51 Tage Krieg in zwei
großen, länger dauernden Agonen fassbar, zum einen in dem sozial determi-
nierten, von Statusdenken geprägten Achill-Agamemnon-Agon,
12
zum anderen
in dem durch retardierende Momente sich verlängernden Zweikampf zwischen
Achill und Hektor. Beide verkörpern zugleich als ihre Protagonisten die zwei
Seiten im Gruppenkonflikt hier der Achaier und da der Troianer.
Mit Wilamowitz und sogar Latacz stimmt Frank Kolb in dem Punkt überein,
dass, wie schon gesagt, nicht der Krieg vor Troias Mauern, „sondern der Zorn
Achills und seine Auswirkungen auf die Gemeinschaft, der er angehörte“, das
Grundthema der „Ilias“ sind.
13
Kolb geht aber noch wesentlich weiter. Er veror-
tet, darin Erich Bethe und dessen „Sage vom Troischen Krieg“ (1927) folgend,
14
8
U. von Wilamowitz-Moellendorf, Die Ilias und Homer, Berlin , S. 114f.
9
Ebenda, S. 98 Anm. 1. Es geht um Lauf und Verfolgung Hektors, also die Umrundung Troias.
„Demetrios kannte den Ort und leugnet die Möglichkeit, bei Strabon 599. Ich leugne sie auch,
weil ich den Ort darauf geprüft habe“. Siehe auch F. Kolb, Tatort „Troia“. Geschichte. Mythen.
Politik, Paderborn etc., 2010, S. 43.
10
Ebenda, S. 95.
11
J. Latacz, Troia und Homer. Der Weg zur Lösung eines alten Rätsels, Leipzig 2005, S. 215 f.,
220, 226. Latacz meint (S. 228), dass sich „zugespitzt“ sagen ließe: „Es ist seine (Homers – A.
J.) Achilleus-Geschichte – und eigentlich dürfte das ganze große Werk aus diesem Grunde auch
nicht ‚Ilias’, ‚Lied von Ilios’, sondern müsste ‚Achilleis’, ‚Lied von Achilleus’ heißen“.
12
E. Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Polisgesellschaft. Studien zum griechischen Adel in ar-
chaischer und klassischer Zeit, Stuttgart 1989, S. 29f., 52f., 54.
13
F. Kolb, a. a. O., S. 71.
14
E. Bethe, Dichtung und Sage, Bd. 3. Sage vom troischen Krieg, Leipzig/Berlin 1927.