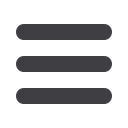34
Wettbewerbsbedingungen, um die Beachtung der Regeln, das richtige Verhalten
der Wettkampfteilnehmer oder die Befolgung anderer Vorschriften ging.
Eine Kontrolle des Agons, des agonalen Spiels, eine außerhalb seiner installierte
Richterfunktion waren im Sinne seines Funktionierens und seiner Wiederholbar-
keit unabdinglich, denn Betrug, Bestechung und Manipulation waren keine Sel-
tenheit. Bei Regelverstößen, die immer wieder vorkamen, musste scharf durch-
gegriffen werden. J.- F. Lyotard hebt diesen Dritten oder die dritte Position im
Agon unter Bezug auf den Widerstreit von Agon und Dialog besonders hervor.
24
Diese dritte Position, so J.- F. Lyotard, nehmen genau die ein, „die von der Bühne
des Dialogs ausgeschlossen“, aber zur Urteilsfindung aufgerufen sind. Bei den
Kampfspielen zu Ehren des Patroklos hatten Achill, der Veranstalter, und sein
greiser Lehrer Phoinix als dessen Gehilfe diese dritte Position inne. Aber dane-
ben spielten auch die anwesenden Achaier eine wachsame und wertende Rolle,
dann nämlich, wenn sie auf den Abbruch des jeweiligen Agons drängten, weil der
Wettkampf aus dem Ruder lief und Gefahr für das Leben drohte. Der Einsatz bei
einem Agon konnte sehr hoch sein. Im „schmerzhaften Faustkampf“ zu Ehren
des Patroklos, erhielt Eurylaos einen so mächtigen Schlag, dass er k. o. ging. Die
Gefährten schleppten ihn vom Kampfplatz: „Er ließ die Füße hinterherschleifen,
spie dickes Blut und neigte den Kopf zur Seite. Sein Bewusstsein schwand ...“
Wie aber sah der Spielgewinn aus, weshalb nahmen die Teilnehmer die Mühen
eines Wettkampfes auf sich, warum wurden Agone veranstaltet? Dem Sieger,
ja allen Teilnehmern der unter Achills Patronat stehenden Spiele winkten hohe
Sachwerte, die zum Teil Statussymbole waren: Dreifüße (Wert beispielsweise 12
Rinder), Bronzekessel, silbernes Tischgerät, kunstfertige und schöne Sklavinnen,
Stiere, Maulesel, Gold, Waffen und – als etwas ganz Besonderes – ein Klumpen
reines Roheisen, der für „fünf volle Jahre“ ausreichte, um den Bedarf einer grö-
ßeren Wirtschaft zu decken. Auch wenn später der Gebrauchswertcharakter der
Preise spürbar zurückging und sich zunehmend der bescheidene Siegerkranz aus
Lorbeer, Efeu, aus Fichten- oder Olivenzweigen durchsetzte, gänzlich ließ sich
der materielle Anreiz, den ein Agon bot und offensichtlich bieten musste, nicht
ausschalten. Noch bedeutsamer als der materielle Gewinn waren ganz sicher der
Ruhm, der Erste, der Beste zu sein, und die sich daran knüpfenden Ehrungen
immaterieller Art.
25
24
J.-F. Lyotard, Der Widerstreit, München 1987, S. 53 f.
25
E. Stein-Hölkeskamp, a. a. O., S. 22, 33; auch Michael Stahl, Aristokraten und Tyrannen in
Athen. Untersuchungen zur Überlieferung, zur Sozialstruktur und zur Entstehung des Staates,
Stuttgart 1987, S.86-89.