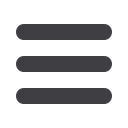37
Achäern vor Troia ebenso wie in und unter den griechischen Aristokratenge-
schlechtern insgesamt, und das nicht nur in der archaischen Zeit (8. - 6. Jh. v.
u. Z.), und er war symbolhaftes Zeichen exklusiver Abgrenzung zu den sozial
Andersartigen: zur grauen Achaiermasse vor Troia, später dann zum Demos oder
im speziellen Falle zu den so genannten „Staubfüßlern“ in Epidauros bzw. zu den
bäuerlichen Standesgenossen Hesiods in Böotien. Aber es blieb nicht dabei.
Das agonale Ereignis wirkte rückkoppelnd hinein sowohl in die Gesamtheit der
griechischen Welt, als auch – über die Sieger – in die einzelne Polis und den
Geschlechterverband. Die einzelne Polis war stolz auf ihren Sieger, identifizierte
sich mit ihm, rühmte sich seiner und benutzte ihn im politischen Agon um den
Rang der besseren, bekannteren, bedeutenderen, der mächtigsten Polis.
III.
An dieser Stelle sollen das zum Modellfall „Leichenspiele zu Ehren des Patro-
klos“ Gesagte und die sich daran knüpfenden Überlegungen zusammengefasst
werden. Agone mit ihrem Spielcharakter, ganz gleich ob gymnische, hippische,
musische oder sonstige, sind erstens, ohne einen über das Prozedurale hinausge-
henden Grundkonsens nicht denkbar. Die Teilnehmer haben ehrlich und nach den
Regeln miteinander zu wetteifern, menschlichen Anstand zu wahren und sich
jedweder Manipulation zu enthalten. Das berühmte Fairplay ist gefordert, das
sich natürlich auch auf das zuschauende, wertende Publikum bezieht. Zum Agon
gehört zweitens, auch dann, wenn sich die Vergleichswerte in klarer Weise ob-
jektivieren lassen, eine so genannte „dritte“ Partei, eine kontrollierende und rich-
terliche Instanz, die unbestechlich und gerecht zu sein hat. Drittens setzt die Teil-
nahme am Agon bei Agonisten wie Kampfrichtern, Ordnern etc. Professionalität
und Kompetenz voraus, und letztere ist auch bei einem Großteil des Publikums
anzunehmen. Ein viertes Merkmal der Agone ist ihre Kommensurabilität, d. h.
nur Gleichartiges kann sich im Agon aneinander messen, kann miteinander wett-
streiten, also Wettläufer gegen Wettläufer, Pankratiast gegen Pankratiast, Flö-
tenspieler gegen Flötenspieler, Redner gegen Redner etc. Der Wettstreit verläuft
innerhalb einer Diskursgattung bzw. Diskursart. Ein Kampf Mensch gegen ein
Pferd (Schnelligkeit) wäre theoretisch denkbar, und wir wissen ja aus der Praxis
der Gladiatorenkämpfe, dass im Aufeinandertreffen von eigentlich inkompatib-
len Kampfarten ein gewisser, die Nerven kitzelnder Reiz lag, aber hier haben wir
es bereits mit der Entartung des ursprünglichen gymnischen Agons zu tun, der ja
nie den vorsätzlichen Tod eines der Teilnehmer implizierte. Der Wettstreit inkom-
patibler Diskurse, der im herkömmlichen Verständnis nie agonimmanent war, ist
als transformierte Erweiterung des agonalen Prinzips eine spätere Erscheinung.