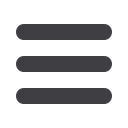36
„Eine spezifische Weise, sich aufeinander zu beziehen, ... das war der Wettbe-
werb, das Agonale“, so Christian Meier,
28
und der Agon wirkte in diesem Sinne
als statuskonstituierende, normative Kraft.
29
So verstanden es die wenigen Teil-
nehmer an den Leichenspielen des Patroklos, Achill, der Veranstalter, und gewiss
auch ein Teil der Zuschauer und – nicht weniger wichtig – der dem Epos zeitge-
nössischen Rezipienten. Man war unter sich und genoss offenbar die Exklusivität
agonaler Selbstäußerung und -bestimmung. Diese sozial oder politisch korporati-
ve Eingegrenztheit des aktiven wie passiven Diskurskreises stellte unzweifelhaft
eine Besonderheit der griechischen agonalen Praxis dar.
Bereits Burckhardt hatte die enge Verbindung des Agonalen mit dem Sozialen,
also der sozialen Oberschicht herausgestellt, nicht mit der Aristokratie einer nicht
mehr erlebbaren mykenischen Vorzeit, sondern mit jener Aristokratie, die mit
der Entwicklung der frühen Polis verbunden und dem Dichter – sprich Homer
– zeitgenössisch war.
30
Es ist die Realität aristokratischer Lebensart im 8./7. viel-
leicht sogar 6. Jh. v. u. Z., die uns aus dem Umfeld der Agone in der „Ilias“ ent-
gegentritt. Das aristokratische Selbst- und Werteverständnis, die aristokratische
Erwartungshaltung jener Jahrhunderte wird in die Vergangenheit rückprojiziert
und das scheinbar Vergangene wird von den Rezipienten aus eben dieser Zeit
als das Ihre, das Standesgemäße ihres sozialen Wir empfunden und wieder auf-
genommen. Diese doppelte Reziprozität ist es, die der „Ilias“ eine für die Zeit
ihrer Abfassung rezeptiv-aktuelle Wirkung verleiht, die letztlich aus dem Troia-
Mythos heraus- und in spätere Jahrhunderte hineinführt.
31
„Das Jahr übt eine
heiligende Kraft
;
Was grau für Alter ist, das ist ihm göttlich. Sei im Besitze, und
du wohnst im Recht, Und heilig wird’s die Menge dir bewahren“ (F. Schiller,
Wallensteins Tod, 215 – 218).
Der Agon wirkte im Kleinen wie im Großen identitätsstiftend. Er förderte das
Bewusstsein korporativer Verbundenheit und Solidarität unter den vornehmen
28
Christian Meier, Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte, Berlin 1993, S. 132 und 135: „Überall
fühlten sich die Griechen in Konkurrenz mit anderen“. Um eine besondere, wenngleich moderne
Form agonaler Gegenseitigkeit scheint es Lou Andreas-Salomé in einem Brief an Rilke zu ge-
hen (K. Asadowski (Hrsg.), Rilke und Russland. Briefe. Erinnerungen. Gedichte, Berlin/Weimar
1986, S. 18). Sie meint, dass Kunst und Leben „denjenigen Punkt des Zusammenschlusses fin-
den“ müssten, „wo eins dem anderen zum Produktivpunkt dient“ – ein interessanter und ernst zu
nehmender Gedanke, der die Kunst im Wettstreit mit dem Leben sieht.
29
E. Stein-Hölkeskamp, a. a. O., S. 53.
30
J. Burckhardt, GK 4, S.100-102, 124.
31
E. Stein-Hölkeskamp, a. a. O., S. 16- 22 (2. Kapitel: Helden und Aristokraten. Epos und Realität
im achten Jahrhundert); auch J. Latacz, a. a. O., S. 219 erkennt an, dass Homer in der „Ilias“ die
„aktuellen Fragen des achten Jahrhunderts“ aufgreift und sie zu seinem Thema macht; dazu
eindeutig F. Kolb, a. a. O., S. 63, 73 (rückt die Zeit bis in das 7. Jh. v. u. Z. vor).