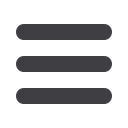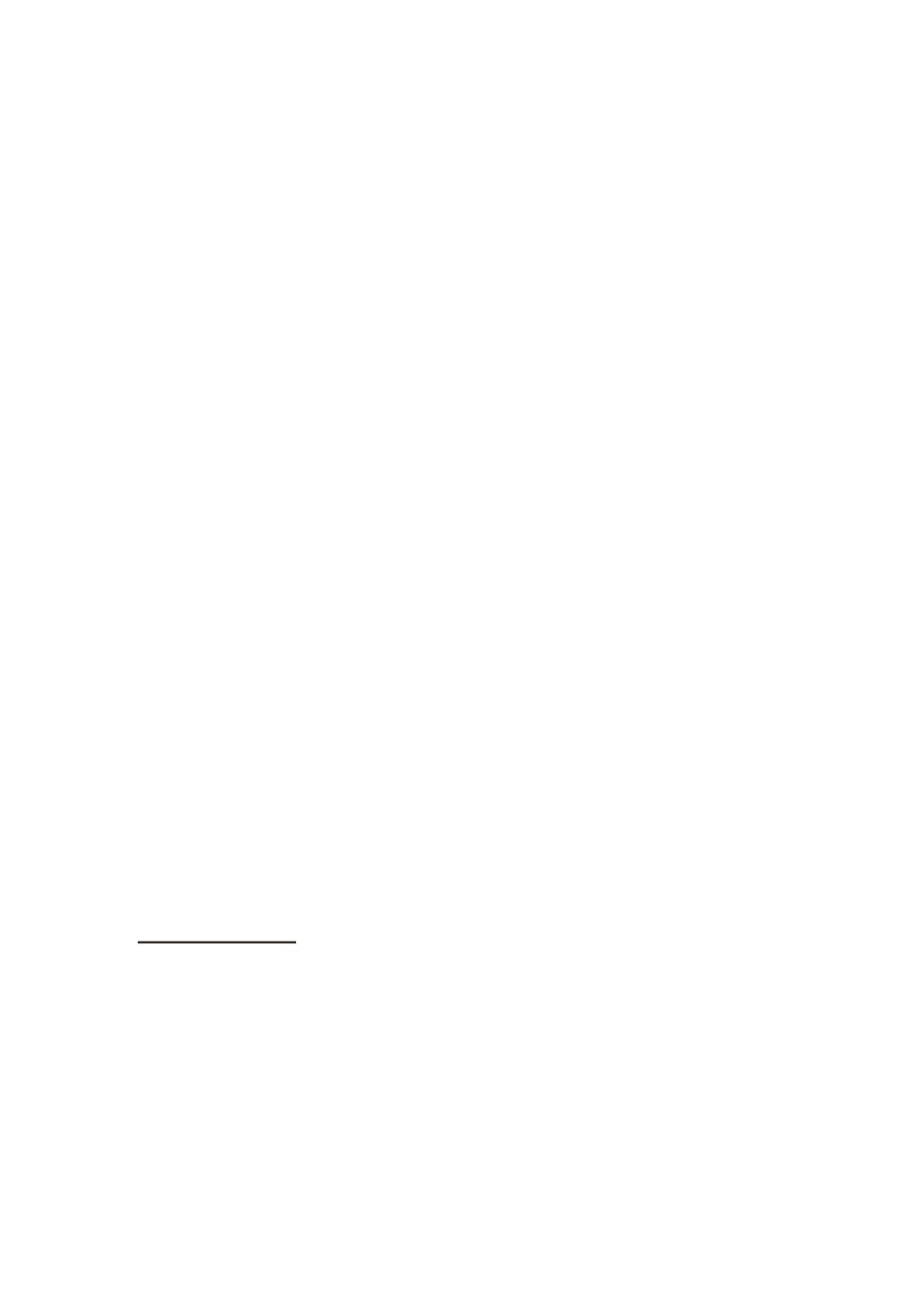
27
Der Beste sein – Das agonale Prinzip in Homers „Ilias“
zwischen Spiel und Wirklichkeit
Armin Jähne
Jakob Burckhardt schreibt im 4. Band seiner epochalen „Griechischen Kultur-
geschichte“ im Kapitel 2 „Der koloniale und agonale Mensch“ das Folgende:
„Und nun das Agonale. Während die Polis einerseits das Individuum mit Ge-
walt emportreibt und entwickelt, kommt es (das Agonale – A. J.) als eine zweite
Triebkraft, die kein anderes Volk kennt, ebenso mächtig hinzu, und der Agon ist
das allgemeine Gährungselement, welches jegliches Wollen und Können, sobald
die nötige Freiheit da ist, in Fermentation bringt. In dieser Beziehung stehen die
Griechen einzig da“.
1
Soweit Burckhardt! Der Begriff des Agons ist, trotz seiner
Eindeutigkeit, im Sinne von Kampf oder Wettstreit jeglicher Art gebraucht zu
werden, in sich differenziert. Mit ihm kann der Fest- oder Kampfplatz ebenso be-
zeichnet werden wie der sportliche und musische Wettkampf, das Wagenrennen,
der Wettkampf oder das Kampfspiel per se, aber auch der Redekampf vor Gericht
(„Agon“ als „der stehende
terminus technicus
für ‚Prozeß’“),
2
der politische Par-
teienkampf oder der Krieg als militärischer Agon. Mit Agon können des Weiteren
allgemein die Anstrengung, eifrigstes Bemühen oder soziales Durchsetzungs-
vermögen, die soziale Selbstbehauptung gemeint sein.
3
Seine Anwendung hat
sowohl eine spielerische als auch eine sehr realitätsnahe Dimension. Ein – in
gewisser Weise – Synonym ist mit der nach Hesiod (Op. 10–29) doppelgesichtig
zu definierenden Eris gegeben, die es in einer älteren, positiven Variante als Göt-
tin friedlichen Wettbewerbs bzw. friedlicher, alltäglicher Konkurrenz (Rivalität)
gibt. „Selbst noch den Trägen erweckt sie in gleicher Weise zur Arbeit. Jeden
ergreift ja die Lust zur Arbeit, wenn er des anderen Reichtum sieht, schon eilt
er zu pflügen, zu pflanzen und das Haus zu bestellen. Der Nachbar läuft mit
dem Nachbarn um die Wette zum Wohlstand; so nützt diese Eris den Menschen“.
Damit ist das agonale Prinzip in die produktive Sphäre, in den Grundlagenbe-
1
J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, Bd. 1-4, Berlin/Stuttgart 1902, 4, S. 89 (ferner
als GK); vergleiche auch H. Bengtson, Agonistik und Politik im alten Griechenland, in: ders.,
Kleine Schriften zur Alten Geschichte, München 1974, S. 190-207. Ch. Meier, Kultur um der
Freiheit willen. Griechische Anfänge – Anfang Europas?, München 2009, S. 166-170 sieht wie
schon Burckhardt im Agonalen, „trotz aller Einwände, die dagegen vorgebracht wurden, … eine
Besonderheit der Griechen“. Siehe auch S. 319 und A. Demandt, Der Idealstaat. Die politischen
Theorien der Antike, Köln etc. 1993, S. 141f.
2
J. Burckhardt, GK 4, S. 121.
3
Siehe die einschlägigen Griechisch-deutschen (englischen, russischen, französischen etc.)
Wörterbücher.