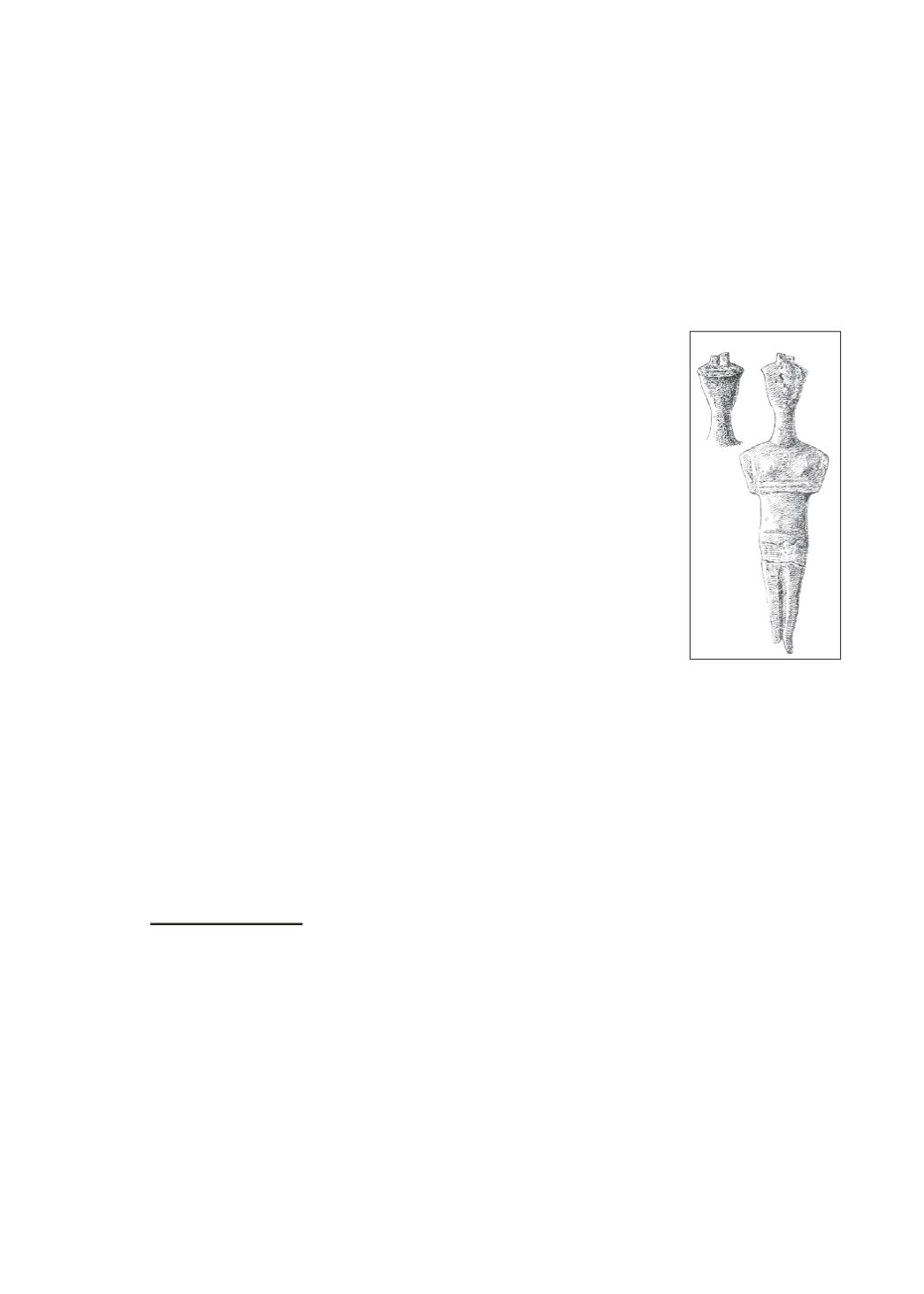
25
Von einheimischen Bauern erfuhr er von den Kontexten, in denen die marmornen
„Inselidole“, normalerweise zusammen mit Marmorgefäßen und Obsidianklingen
auftraten
12
, und nannte auch Inseln, auf denen sie häufig zu finden sind. Explizit
äußerte er sich dazu in seinen erst 1855 erschienenen Archäologischen Aufsätzen,
als er einen Artikel allein den prähistorischen Funden der Kykladen widmete
13
. Er
bespricht die Kontexte, in denen Marmorfiguren, Marmorgefäße und Obsidianklin-
gen gemeinsam auftreten und beschreibt hier erstmalig Charakteristika frühkykla-
discher Grabgebräuche. Die Idole empfindet er weniger als rohe Erzeugnisse, er
möchte lieber von einem „conventionellen Typus“ sprechen
14
. Als Deutung schlägt
er Astarte oder Aphrodite vor, versieht dies jedoch mit einem
Fragezeichen. Er stellt die Überlegung an, ob die frühkykladi-
schen Idole nicht vielleicht Aufschluss über die aus schriftli-
chen Quellen bekannte phönikische, karische, pelasgische oder
minoisch-kretische Besiedlung der Inseln geben könnten
15
.
Letztendlich möchte er sich aber nicht der von Thiersch vor-
gebrachten karischen Deutung vorbehaltlos anschließen, da für
ihn die chronologische Frage nicht hinreichend geklärt ist
16
.
Wir wissen, dass Ludwig Ross auch selbst Kykladenidole be-
saß: „Ich selbst besitze eine Figur dieser Art von Paros von
neun Zoll Länge, die zu den grössten und am meisten aus-
geführten gehört, welche mir vorgekommen sind“
17
. Mit der
Bemerkung zur Ausführung meint Ross, dass das Idol Ge-
sichtsmerkmale hatte, was bei den meisten anderen damals
bekannten Figuren nicht der Fall war. Die Figur wurde 1860
von Emma Ross der Berliner Antikensammlung verkauft und
befindet sich heute noch dort
18
. Zwei andere Idole schenkte
Ross 1838 durch Vermittlung des dänischen Generalkonsuls
Christian Tuxen Falbe dem Kronprinzen von Dänemark, Chri-
stian Frederik, später König Christian VIII. Diese beiden Fi-
guren befinden sich heute im Nationalmuseum Kopenhagen
und sind deren erste frühkykladischen Altertümer (Abb. 4)
19
.
12
Ross 1838, 408 f.
13
Ross 1855, 52–55.
14
Ross 1855, 53.
15
Ross 1838, 408 f.
16
Ross 1840, 161 Anm. 15; Ross 1855, 54 f.
17
Ross 1855, 54.
18
Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, Inv. Nr. 8429. Für den Hinweis danke ich H. Löhr
vom Antikenmuseum der Universität Halle-Wittenberg. Die Provenienzangabe der Figur lautet
heute allerdings Delos.
19
Rasmussen 1989, 71 f.
Abb. 4 – Eines der
beiden Idole, die
L. Ross dem däni-
schen Kronprinzen
schenkte (National-
museum Kopenha-
gen, Inv. Nr. ABb
19). Es ist eines der
ganz wenigen ech-
ten Doppelidole.









