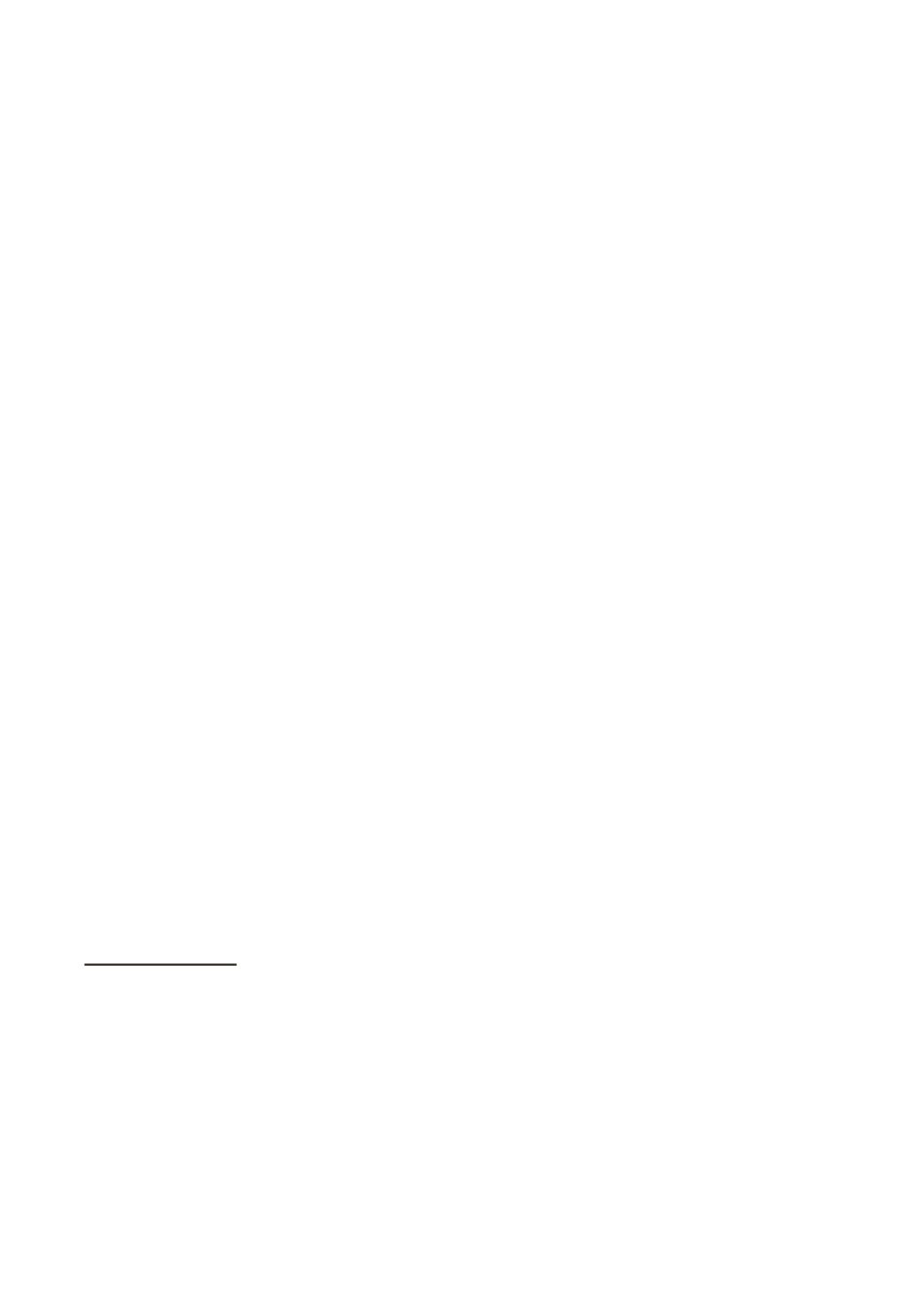
28
sen, August Speyer, geschenkt. Dieser wiederum schenkte es der fürstlich waldek-
kischen Antikensammlung von Arolsen. Rudolf Gaedechens beschrieb die Figur
dann in seinem 1862 erschienenen Bestandskatalog
24
. Über den Umweg einer
Privatsammlung gelangte es schließlich in das Landesmuseum Württemberg in
Stuttgart
25
.
Die hier beschriebene „Feldforschung“ und deren Funde sollten für weniger reise-
freudige Gelehrte eine Grundlage bilden, sich mit den bis dahin bekannten Zeug-
nissen der frühkykladischen Kultur auseinanderzusetzen. Dabei spielten allein
die Idole eine Rolle, Gefäße dagegen waren weniger interessant, obwohl manche
schon bekannt waren. Bereits 1830 wurde in Karl Otfried Müllers (1797–1840)
„Handbuch der Archäologie der Kunst“ das von Walpole publizierte Idol bespro-
chen
26
. Hier schlich sich auch der noch lange kopierte Fehler ein, als Material der
Idole nicht Stein, sondern Ton anzunehmen, da Walpoles Bezeichnung Sigillarium
missverstanden wurde
27
. 1835 publizierte Müller zusammen mit Carl Oesterley
(1805–1891) das Werk „Denkmäler der alten Kunst“ und bildete unter dem Stich-
wort „Roheste Arbeiten aus Terrakotta“ das Walpolesche Idol ab
28
. Mit diesen bei-
den Arbeiten hatten Kykladenidole schon früh Eingang in archäologische Über-
blicksliteratur, so dass nun weiterführende Literatur darauf Bezug nehmen konnte.
Eduard Gerhard (1795–1867) beschrieb die kykladischen Idole in seiner 1848 er-
schienenen Abhandlung „Ueber die Kunst der Phönicier“ folgendermaßen: „Auf
Inseln des ägäischen Meeres haben in ähnlicher Kleinheit Steinbildchen sich vor-
gefunden, deren Rohheit sogar an karischen Ursprung hat denken lassen und, da
ein solcher nirgend mit Kunstanfängen bekannt ist, am füglichsten auf Phönicier
verwiesen wird [...] man könnte meinen, sofern die Urzeit der Kunst überhaupt
Meinungen verträgt, hier sei dädalische Kunst dem bildlosen phönicischen Kultus
zu Hülfe gekommen [...]“
29
. Als Illustration zeigt er auf einer Tafel die drei bei
Fiedler publizierten Idole und das von Thiersch vorgestellte Doppelidol. Eduard
Gerhard lieferte mit seinen Überlegungen eine alternative Deutung für Thierschs
Idee, es könne sich bei den Idolen nur um Produkte karischen Kunstschaffens
handeln und deutete die Idole als Produkte der Phönizier, wobei er aber einen
gewissen griechischen Einfluss nicht ausschließt.
24
Gaedechens 1862, 22 Nr. 2.
25
1928–1959 Sammlung Dr. Heinrich Scheufelen. Ab 1959 Landesmuseum Württemberg, Stuttgart,
Inv. Nr. 1.64. Ich danke an dieser Stelle Dr. N. Willburger für die freundliche Publikationserlaubnis
und V. Amer, die mir das Idol im Magazin zugänglich machte.
26
Müller 1830, 48 f. Nr. 72, 1.
27
Darauf wies bereits Wolters 1891, 57 hin.
28
Müller – Oesterley 1835, 2 Nr. 15. Taf. 2 Nr. 15.
29
Gerhard 1848, 14 Taf. 4 Nr. 1–4.









