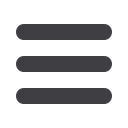44
Das Burgareal von Troia VI (1750-1300) wurde in der Spätzeit von einer 530 m
langen, 1,8 ha umfassenden, bis zu einer Höhe von 8 m erhaltenen Steinquader-
Mauer umgeben, auf der noch ein Lehmziegel-Oberbau ruhte. Die Mauer weist
im Nordosten eine beeindruckende Bastion auf sowie zwei Türme am Süd- und
Osttor. Insgesamt vier Tore gewährten Zugang zur Burg. Innerhalb des Burgare-
als wurden große, freistehende Einzelgebäude errichtet, darunter megaronartige
Bauten und ein zweistöckiges Haus mit Stützpfeilern. Insgesamt gibt es Reste von
etwa 17 Gebäuden, die freilich keineswegs gleichzeitig entstanden und existier-
ten. Sie scheinen auf ringförmig ansteigenden Terrassen gestanden zu haben; al-
lerdings hat Schliemann offensichtlich keine Terrassierung bis zum Burgzentrum
festgestellt. Wie das Zentrum der Burganlage aussah, ist unklar; es könnte sich
dort durchaus ein freier Platz befunden haben, wie dies jedenfalls für frühbronze-
zeitliche Siedlungen mehrfach belegt und für Troia I sowie für die früheste Phase
von Troia II, aber auch für Troia VII a wahrscheinlich ist. Gebäudereste außerhalb
des Burgareals sind fast ausschließlich im unmittelbaren Vorfeld der Burgmau-
er gefunden worden – mit Ausnahme einer Hausecke etwa 170 m südöstlich der
Burgmauer und eines von Carl Blegen entdeckten, als Krematorium gedeuteten
Lehmziegel-Gebäudes 400 m südlich, in der Nähe eines Friedhofareals. Eine die
Außensiedlung umschließende Siedlungsmauer existierte offenbar nicht.
Die folgende Siedlungsperiode Troia VII a (13. Jh.) markiert eine ärmlichere Pha-
se hinsichtlich der Bausubstanz; die Befestigungsmauer bleibt die gleiche, und die
erkennbare Siedlungsausdehnung verändert sich gleichfalls nicht. Dörpfeld äußer-
te sich überrascht, zum Burginneren hin keine VII a-Bauten feststellen zu können.
Dort befand sich mithin möglicherweise ein freier Platz.
Bei dem nun folgenden Vergleich mit anderen westkleinasiatischen prähistorischen
Siedlungen ist zu berücksichtigen, dass wir weder für die Hisarlık-Siedlungen
noch für die nun zu besprechenden Beispiele irgendwelche zuverlässigen Ein-
wohner- oder Gebäudezahlen bestimmen können. Der Vergleich kann sich jeweils
nur auf die Rekonstruktion der Gesamtanlage der Siedlung, auf die Fläche des mit
einer Mauer befestigten Areals und auf Rückschlüsse aus den erhaltenen Gebäu-
deresten sowie sonstigen Befunden stützen.
Der vorgesehene Rahmen meines Beitrags erlaubt selbstverständlich nur einen
kurzen Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde bei meinem
Durchmarsch im Süden beginnen und mich bis in die Umgebung von Hisarlık
vorarbeiten
3
(Abb. 1).
3
S. zum Folgenden auch K. Strobel, Neues zur Geographie und Geschichte des alten Anatolien. In:
K. Strobel (Hrsg.), New Perspectives on the Historical Geography and Topography of Anatolia in
the II and I Millennium B. C. (Eothen 16), Florenz 2008, 9-61.