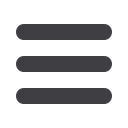117
– wissentlich oder unwissentlich – strickten, wurde mit den Arbeiten von Calder
und Traill dekonstruiert: Der Heros wurde vom Sockel gestoßen und in ein völlig
neues und gegenüber der früheren Forschung anderes Licht gerückt.
Calders quellenkritisch vorbildliche Arbeit war damals in zweierlei Hinsicht
revolutionär: Er war nicht nur der Erste, der an einem Mythos zu kratzen be-
gann; für weit mehr Furore sorgte überdies sein Schluss, man könne nicht umhin,
Schliemann als pathologischen Lügner zu bezeichnen.
6
Damit trat er eine Lawine
los, die die Schliemannforschung zwar grundlegend veränderte und erneuerte,
sie aber zugleich ungewollt auf einen Aspekt einengte und meines Erachtens da-
mit letztlich auch für einige Jahre blockierte.
Es war in der Folge besonders David A. Traill, der in den 1980er Jahren Schlie-
manns Selbstzeugnisse auf „Herz und Nieren“ prüfte und weitere Phantastereien
und Unwahrheiten ans Licht brachte.
7
Zunehmend gab es jedoch Kritik an Traills
Vorgehen, das als zu einseitig – lediglich auf die Desavouierung Schliemanns
ausgerichtet – betrachtet wurde;
8
einige Forscher warfen ihm daher einen Hang
zur Obsession vor. Zu ihnen gehörte auch Donald F. Easton (z. B. 1994a), der sich
mit Traill in den 1980er und 1990er Jahren in zahlreichen Beiträgen einen erbit-
terten, aber fairen „Kampf“ um Schliemanns Glaubwürdigkeit lieferte.
9
Seine
Lesart der Quellen war eine andere: Er wies darauf hin, dass Unstimmigkeiten in
den Selbstzeugnissen einerseits nicht zwangsläufig auf pathologische Lügenhaf-
tigkeit hinweisen müssen, und dass andererseits diese recht einseitige Deutung
Schliemanns fraglos zwiespältigem Charakter nicht gerecht würde (Easton 1984,
203).
10
Anstatt sich in Details zu verrennen, sei es wichtiger, alle Zeugnisse in den
Blick zu nehmen und differenzierter zu urteilen. Traill, so schrieb er, sehe den
Wald vor lauter Bäumen nicht (Easton 1994a, 456).
6
Calder spricht von „pathological liar“ (1972, 352) oder auch „pathological mendacity“ (ebd. 344).
7
Einen guten Zugriff auf die Arbeiten Traills hat man über seine Textsammlung „Excavating
Schliemann“ (Traill 1993).
8
Beispielsweise Bloedow 1988; Carvalho 1995; Easton 1994a. – Speziell Traills Beitrag
„Schliemann’s Acquisition of the Helios Metope and His Psychopathic Tendencies“ (1986) wurde
kritisiert. Traill versucht darin in systematischer Manier – basierend auf sozial-psychologischen
Erkenntnissen –, Schliemann als psychopathische Persönlichkeit darzustellen. Schindler (1992b,
139) kommentierte diesen Beitrag in der Rückschau folgendermaßen: „Unfortunately, this paper
has damaged the critical investigation of Schliemann“. Bereits Calder (1972, 348; 349) verwen-
dete den Begriff „psychopathy“. Sowohl Calder als auch Traill dürften durch die Studien des
Psychiaters W. G. Niederland (1965; 1971) über Schliemann zu ihren Deutungen inspiriert wor-
den sein.
9
Siehe z. B. Easton 1981; 1984; 1992; 1994b; 1998.
10
Ähnlich auch Schindler 1992b, 138 f.