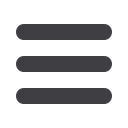115
welche Auswirkungen sie auf das Bild des Entdeckers hatten und wie sie es ver-
änderten.
4
Die wohl bekannteste „biographische Nachinszenierung“ (Schindler 1976, 280)
ist der von Schliemann in seinen autobiographischen Schriften kolportierte Kind-
heitstraum, er werde einst das sagenhafte Troia ausgraben. In seinem 1881 er-
schienenen Werk
Ilios
schildert er in hinreißender Manier das Weihnachtsfest des
Jahres 1829, als er das damals beliebte Jugendbuch
Weltgeschichte für Kinder
von
Ludwig Jerrer geschenkt bekam. Das Titelbild ziert eine Szene aus der Ilias und
zeigt den aus dem brennenden Troia fliehenden Aeneas. Dieses Bild beschäftigte
den Siebenjährigen offenbar sehr. Damals sei er mit seinem Vater übereingekom-
men, er werde einst die Mauern Troias ausgraben (Schliemann 1881, 3 f.). Rück-
blickend stilisierte Schliemann dieses Weihnachtsfest zu einem Schlüsselereignis
für seine späteren Ausgrabungen. Heute wissen wir, dass dieser „Traum“, den er
ganz bewusst verbreitete, seiner Phantasie entsprang und frühestens 1868 Ge-
stalt annahm. Er beabsichtigte damit, seinem recht ungewöhnlichen Lebensweg
– vom Kaufmann zum Archäologen – einen Sinn zu geben, indem er den von ihm
angeblich seit Kindertagen gefassten „Traum“, Troia auszugraben, Wirklichkeit
werden ließ.
Andere ähnlich erfundene Episoden Schliemanns ließen sich anführen. Erinnert
sei nur an das von ihm in seinem Amerika-Tagebuch beschriebene Treffen mit
dem amerikanischen Präsidenten Millard Fillmore in Washington 1851, mit dem
er anderthalb Stunden geplaudert haben will, sowie seine Erwähnung des an-
schließenden Empfanges mit insgesamt 800 Gästen (Stoll 1986, 72 f.) oder die
angeblich von ihm miterlebte Feuersbrunst in San Francisco desselben Jahres
(dazu Traill 1979). Auch hier ging seine Phantasie offenbar mit ihm durch. Ähn-
liches gilt für die Behauptung, er sei am 4. Juli 1850 amerikanischer Staatsbürger
geworden (Schliemann 1881, 15) – auch dies ist eine Geschichte bar jeder Wirk-
lichkeit. Amerikanischer Staatsbürger wurde er erst, als er 1869 ein drittes Mal in
Amerika weilte, um sich von seiner ersten Frau scheiden zu lassen.
Das bekannteste Beispiel ist gewiss die Inszenierung, dass seine zweite Frau So-
phia bei der Entdeckung des sogenannten „Priamosschatzes“ 1873 in Troia anwe-
send gewesen wäre. Seine Darstellung, seine Frau habe die Goldsachen in ihrem
„Umschlagetuch“ in Sicherheit gebracht, war pure Erfindung, denn Sophia war
erwiesenermaßen nicht in Troia als Schliemann den Schatz fand.
4
Die folgenden Beispiele finden sich bei Calder 1972; Schindler 1976; zur angeblichenAnwesenheit
von Schliemanns Frau bei der Entdeckung des „Priamosschatzes“ s. Traill 1983, 184; 1984, 109 f.