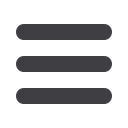123
Die eingehende Beschäftigung etwa mit Emil Ludwig (1881–1948), einem der
bedeutendsten Vertreter der sogenannten „Historischen Belletristik“
22
– einer in
den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg beim Publikum äußerst beliebten literari-
schen Gattung –, hat in der Schliemannforschung bis heute nicht stattgefunden.
Dabei zeigt dieses Beispiel, wie wichtig es ist, sich intensiver mit den Biographen
und ihrer Zeit zu beschäftigen, also über das Etikett „gute“ oder „schlechte“
Biographie hinauszukommen. Als Ludwig, der kein Historiker war, die Schlie-
mann-Biographie schrieb, war er bereits weltberühmt; er hatte schon etliche
erfolgreiche Biographien beispielsweise über Goethe, Napoleon, Wilhelm II.
und Bismarck verfasst, die alle den gleichen Kunstgriffen folgten: Verdichtung,
Dramatisierung und Spannungssteigerung (Porombka 2009, 125).
23
Ludwig und
vielen anderen populären Biographen ging es nicht darum, wissenschaftliche
Biographien zu schreiben und damit etwa neue Quellen vorzulegen; ihr Ziel war
es vielmehr, anhand des vorhandenen Quellenmaterials die Innenwelt ihrer Pro-
tagonisten abzubilden. Sie bezogen daher die Ergebnisse der noch jungen Wis-
senschaft Psychologie in ihre Analyse mit ein – man könnte die Bücher daher
heute auch als „dokumentarische Psychographien“ (Perrey 1992, 175) bezeich-
nen.
24
Die akademische Geschichtswissenschaft der Weimarer Republik stand
solchen Biographien wegen ihrer allzu starken psychoanalytischen Herange-
hensweise ablehnend gegenüber. Ihre Bücher wurden von der Zunft als „illegiti-
me“ Form der Geschichtsschreibung verunglimpft (siehe z. B. Mommsen 1930).
Es dürfte sich also durchaus lohnen, Ludwigs Schliemann-Biographie vor dem
Hintergrund der „Historischen Belletristik“ der Weimarer Zeit zu analysieren.
Sie stellt zwar ein Spätwerk Ludwigs dar, und auch das für die Gattung typisch
„politisch-aufklärerische Engagement“ (Perrey 1992, 170) tritt hier deutlich we-
niger zu Tage. Sie muss aber dennoch in diesem Zusammenhang gesehen und
im Vergleich mit Ludwigs anderen Biographien sowie darüber hinaus ganz all-
gemein mit populären Biographien dieser Zeit vergleichend analysiert werden.
Schluss
Die letzten Punkte sollten verdeutlichen, dass es noch viele offene Fragen für die
Schliemannforschung gibt. Dabei gilt es, nicht nur neue Quellen zu erschließen,
sondern mit neuen Fragestellungen auch an alte Texte – wie gerade das Beispiel
22
Ausführlich zur „Historischen Belletristik“ – übrigens ein von den Gegnern der populären histo-
rischen Biographien eingeführter Kampfbegriff – siehe Gradmann (1993).
23
Ludwig schrieb in den 1930er Jahren: „Der Forscher findet, der Romancier erfindet, der Biograph
empfindet“ (Ludwig 1936, 142).
24
Ähnlich Porombka (2009, 125), der die populären Biographien der Weimarer Zeit als „psycholo-
gische Charakterkunde“ umschreibt.