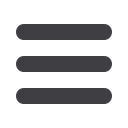113
Nach der Dekonstruktion – Perspektiven der Schliemann-
forschung heute
Stefanie Samida
Man muss sich den Helden also vom Leib halten.
Meier (1989, 101)
Aus der Sicht einer „Nachgeborenen“, die die recht kontrovers und leidenschaft-
lich geführten Diskussionen um Heinrich Schliemann in den etwa zwanzig Jah-
ren von 1972 bis 1992 nur aus der Lektüre der publizierten Arbeiten kennt, haben
die damaligen Diskussionen einerseits entscheidende Impulse für die Schlie-
mannforschung geliefert. Andererseits führten sie aber auch – in der Rückschau
auf diese Zeit – zu einer einseitigen Debatte um Schliemanns Person und die Fra-
ge „Hero or Fraud?“ (Easton 1998). Es ist heute Dank der Forschungen von Wil-
liam M. Calder III und David A. Traill, um die beiden Hauptkritiker Schliemanns
zu nennen, völlig unzweifelhaft, dass der archäologische Laie nicht der war, den
er in seinen zahlreichen Tagebüchern, Briefen und wissenschaftlichen Publika-
tionen vorzugeben beabsichtigte. Sie und andere konnten anhand des intensiven
Quellenstudiums und einer kritischen Betrachtung der Schliemannschen Eigen-
quellen zeigen, dass er das eine oder andere Mal seine Leistungen und Taten in
einer phantastischen Art und Weise heraushob und in Einzelfällen gar bewusst
fälschte. Schliemanns Glaubwürdigkeit ist seitdem fundamental beschädigt und
vieles, was er schrieb, wurde seit den Arbeiten Calders und Traills zu Recht einer
kritischen Lektüre und teilweise einer neuen Deutung unterzogen.
Dass es nach Schliemanns Tod mehr als achtzig Jahre brauchte, bis eine quel-
lenkritisch akzeptable Auseinandersetzung mit ihm und seinem Werk einsetzte,
muss erstaunen. Immerhin waren bis zum Jahr 1972, als William Calder sei-
nen berühmten „Mitternachtsvortrag“ hielt und er damit die Entmythisierung
des populärsten deutschen Archäologen einläutete, bereits mehrere Biographien,
Briefeditionen und zahlreiche Beiträge über Schliemann erschienen. Es bedarf
letztlich keiner besonderen Betonung, dass es zum methodischen Rüstzeug des
Historikers und des Biographen gehören sollte, sich kritisch mit seinen Quellen
auseinanderzusetzen sowie sich verschiedener Quellenarten und Zeugnisse zu
bedienen. Beides, die kritische Auseinandersetzung sowie der Rückgriff auf er-
gänzende Quellen, lassen etwa die frühen Biographien von Emil Ludwig (1932),
Heinrich Alexander Stoll (1958) und Ernst Meyer (1969) vermissen. Gerade die