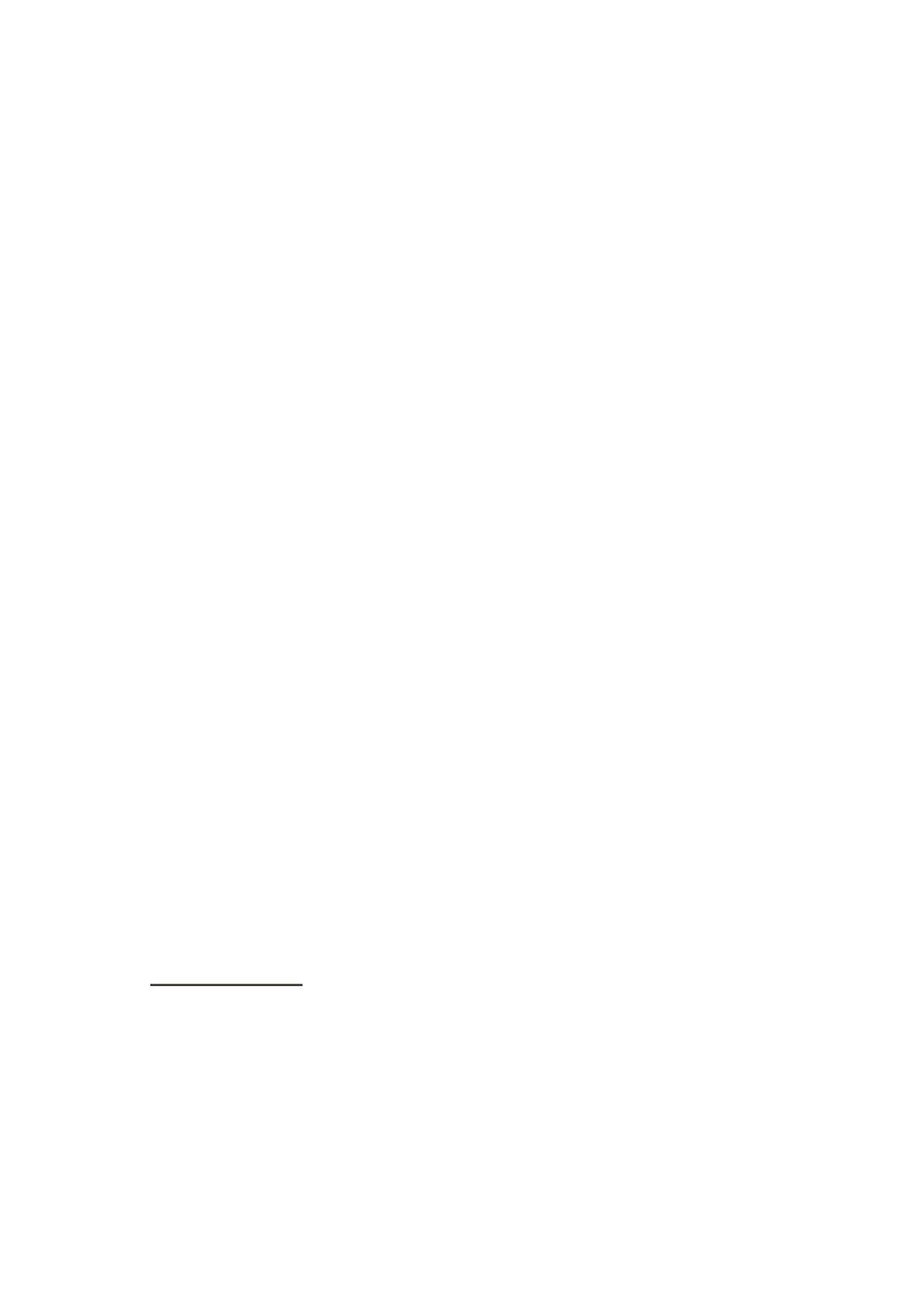
71
6
Luwische Sprache und Schriften
Sprachwissenschaftlich ist der Westen Kleinasiens gut untersucht.
37
Dank der Do-
kumente aus Hattuša konnten Sprachwissenschaftler ein umfassendes Bild der
dortigen Kulturen zeichnen. Die Hethiter haben zur Darstellung ihrer Sprache die
akkadische Keilschrift in einer von Babylonien geprägten nordsyrischen Ausfüh-
rung übernommen. In dieser Schrift hielten sie Texte in verschiedenen Sprachen
fest:
nešili
, der Sprache der Hethiter;
hattili
, der Sprache der hattischen Urbevöl-
kerung;
luwili
(Luwisch), der Sprache des Südens und Westens Kleinasiens; sowie
Palaisch, das im Norden gesprochen wurde und nur mit wenigen Texten vertreten
ist. Hethitisch war vor allem in der Umgebung der späteren Hauptstadt Hattuša,
und dort offenbar in Form einer Hochsprache der Oberschicht, gebräuchlich.
38
In ganz Süd- und Westanatolien und in Nordsyrien sprach man in der Bronze-
zeit und in der frühen Eisenzeit Luwisch, und zwar in verschiedenen Dialekten
(Abb. 7). Das Luwische zählt zum anatolischen Zweig der indoeuropäischen Spra-
che. Der deutsche Linguist Paul Kretschmer hatte bereits 1896 in seiner
Einlei-
tung in die Geschichte der griechischen Sprache
erkannt, dass Ortsnamen mit
den Endungen
-nthos
(wie Tirynthos) und
-assos
(wie Parnassos) vorgriechischen
Ursprungs sind. Der Troja-Ausgräber Carl Blegen griff diese Theorie gemeinsam
mit dem Linguisten Joseph Boyd Haley 1928 in einem Artikel „The Coming of
the Greeks“ auf.
39
Eine ihrer Kernaussagen ist, dass luwische Bevölkerungsgrup-
pen im 3. Jt. v. Chr. in Griechenland eindrangen und dabei auch ihre Sprache
einführten.
40
Im Jahr 1961 nutzte der britische Sprachwissenschaftler Leonard
Robert Palmer, Professor an der Oxford University und Präsident der Britischen
Philologischen Gesellschaft, die vorausgegangene Entzifferung von Hierogly-
phenluwisch zu Rückschlüssen auf die Ägäische Frühgeschichte für sein Buch
Mycenaeans and Minoans
.
41
Palmer sieht eine Reihe von Anzeichen dafür, dass
sich luwische Begriffe bis heute in der griechischen Sprache erhalten haben – ins-
besondere in Ortsnamen, die bekanntlich besonders langlebig sind. Darüber hin-
aus gibt es Hinweise, dass sowohl die kretische Hieroglyphenschrift wie auch die
Linear-A-Schrift einen Bezug zum westlichen Kleinasien hatten. Da bis jetzt sehr
wenige Ausgrabungen in den entsprechenden Schichten des 16. bis 13. Jh. v. Chr.
durchgeführt wurden, bleiben diese Annahmen bis auf weiteres Hypothesen.
37
Heinhold-Krahmer 1977; Melchert 2003; Mouton 2013.
38
Hawkins 2013, S. 27; Aro/Wittke 2015, S. 622; bereits Rosenkranz 1938, S. 265.
39
Haley 1928; Blegen 1928; siehe auch Finkelberg 2005, S. 57; Mouton 2013, S. 5.
40
Siehe auch Strabon 7.7.1: „Aber fast ganz Hellas war vor alters ein Wohnsitz von Barbaren, wie
man aus den Überlieferungen selbst annimmt, indem Pelops Volk aus Phrygien in den nach ihm
benannten Peloponnes einführte“ (Forbiger).
41
Palmer 1961, S. 26; siehe auch Younger/Rehak 2008, S. 176.









