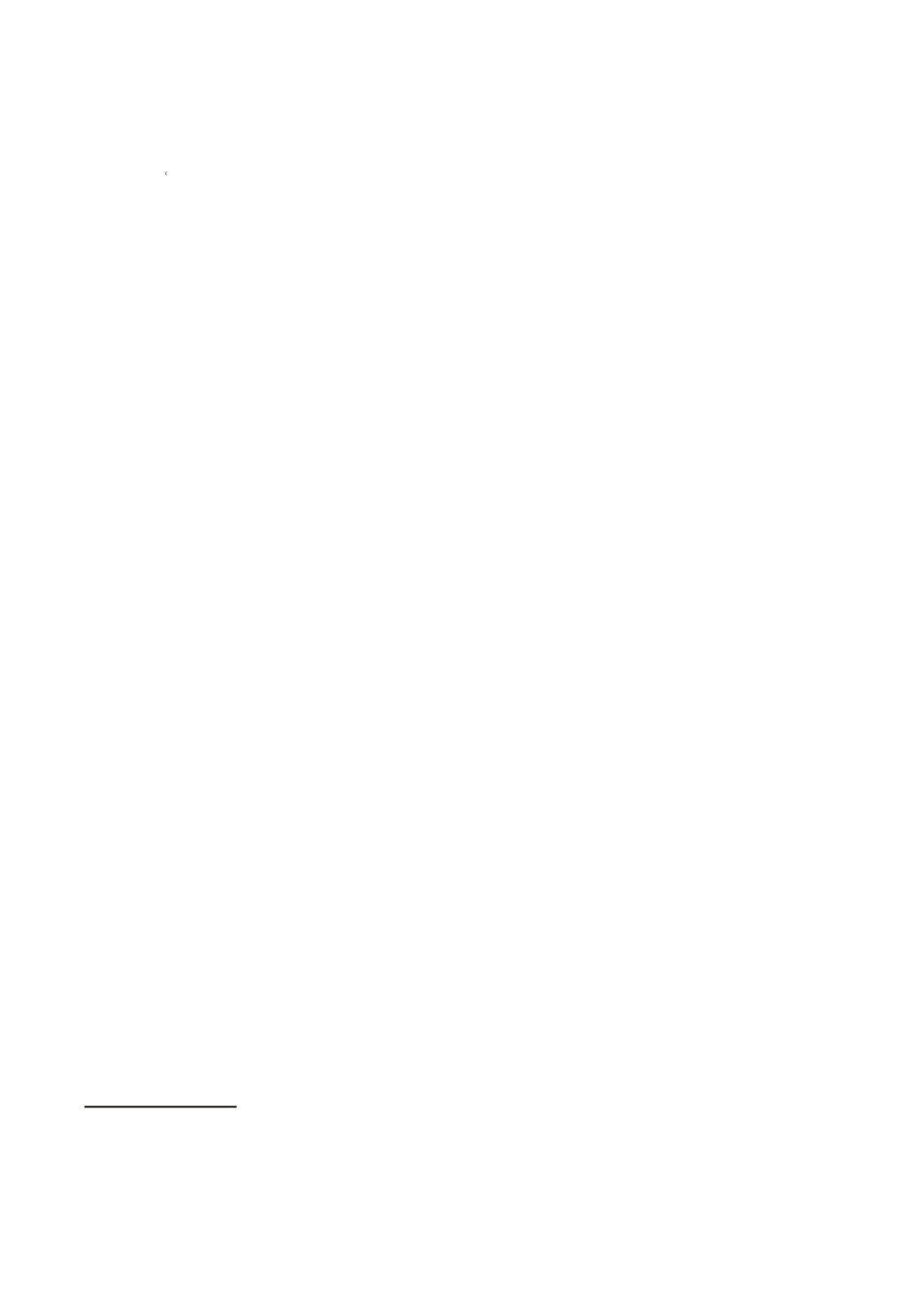
72
Ab etwa 2000 v. Chr. tauchen luwische Personennamen und Lehnworte in den alt-
assyrischen Dokumenten aus der Handelsstadt Kültepe auf. Die damals in Klein-
asien lebenden assyrischen Händler bezeichneten die einheimische Bevölkerung
als
nuwa um
, was „Luwier“ entspricht. Hethitische Gesetze und andere Doku-
mente enthalten Hinweise auf Übertragungen „in luwische Sprache“ wie auch
auf ein Land Luwiya imWesten. Über Jahrtausende hinweg war der überwiegend
von Luwisch sprechenden Völkern bewohnte Süden und Westen Kleinasiens
vermutlich unter anderem aufgrund seiner komplizierten Topografie politisch in
viele Kleinkönigreiche und Fürstentümer zersplittert. Das hat diese Region in ih-
rer wirtschaftlichen und militärischen Bedeutung geschwächt und das Erkennen
eines mehr oder weniger gleichförmigen Kulturkreises verzögert. Schriftkennt-
nisse entwickeln sich in aller Regel aus einem wirtschaftlichen Bedürfnis heraus.
Westkleinasien besaß Rohstoffe – und hatte damit trotz politischer Kleinteiligkeit
frühzeitig einen Bedarf für Schrift.
Neben den keilschriftluwischen Texten existierte auch eine eigenständige luwi-
sche Hieroglyphenschrift. Bereits 1812 sah der schweizerische Orientreisende
Jean Louis Burckhardt, der als erster Europäer Petra und Mekka besuchte, in der
syrischen Stadt Hama Steinblöcke mit unbekannten Hieroglyphen. In der ersten
Hälfte des 20. Jh. wurden viele weitere solcher Inschriften vor allem in Karkemiš
und Hattuša entdeckt, ohne dass Wissenschaftler sie einer Sprache oder Zivilisa-
tion hätten zuordnen können. Im Jahr 1917 entzifferte der österreichisch-tsche-
chische Sprachwissenschaftler und Altorientalist Bed
ř
ich Hrozný die Keilschrift-
tafeln der Hethiter. Daraufhin gelang es dem schweizerischen Assyriologen und
Hethitologen Emil Forrer 1919 erstmals, Dokumente aus den Keilschriftarchiven
in luwischer Sprache zu lesen. Aber erst nach der Publikation des Großteils der
keilschriftluwischen Texte aus Hattuša ab 1953 konnten keilschriftluwische und
hieroglyphenluwische Texte in Relation zueinander gebracht werden, und damit
wurde Hieroglyphenluwisch mit seinen insgesamt 520 Zeichen im Laufe der
1950er Jahre weitgehend verständlich. Die Hieroglyphenschrift lässt sich inzwi-
schen bis 2000 v. Chr. zurückverfolgen
42
und ist während eines Zeitraums von
rund 1400 Jahren, also bis 600 v. Chr., belegt. Die frühesten Zeugnisse sind Be-
amtensiegel, bei denen Name und Titel im Zentrum mit Hieroglyphen geschrie-
ben, aber von Keilschrifttexten umgeben sind.
Vor allem im letzten Jahrhundert des hethitischen Reichs entstanden länge-
re Hieroglypheninschriften. Dazu zählt die 8,5 Meter breite Ni
ş
anta
ş
-Inschrift
(Zeichenstein) in Hattuša, in der der letzte hethitische Großkönig, Šuppiluliuma
42
Woudhuizen 2015, S. 21: „The earliest datable document in an Indo-European tongue.“









