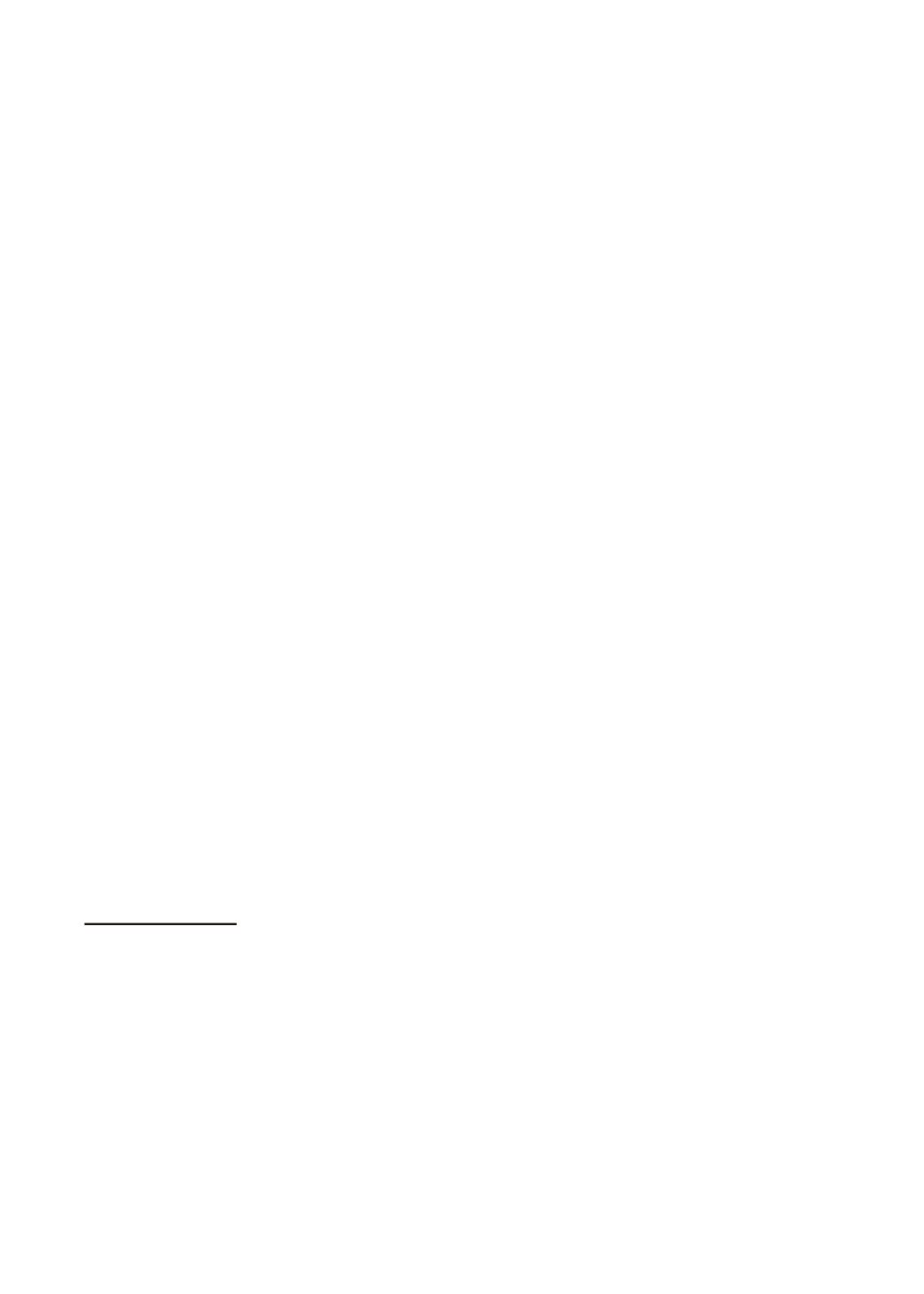
464
kommuniziert werden. Es entsteht ein auf den Besucher hin geordneter partnerbe-
zogener, dialogischer Aufbau.
Zwei abschließende Bemerkungen zur Raumsituation: Es versteht sich, dass wir
bei zumeist fensterlosen Räumen auch mittels Lichtführung Bedeutungen trans-
portieren. Etwa halten wir den Komplex Adelsherrschaft/sozialkritische Idyllik
dunkel, die dunkle Seite steht für ständische Willkür. Die Gegenwelten – auf den
gegenwärtigen heimischen Boden bzw. den antiken Boden gesetzte Wunschbilder
– sind mittels LED-Technik in ein jeweils idealisierendes Licht getaucht. Der apfel-
grüne Glanz, der ausgewählten Elementen der Pfarrhausidylle „Luise“ mit hinein
gespiegelter Amerikautopie
7
unterlegt wird, und der blau-türkise Glanz, der antike
Idealbilder Vossens illuminiert, steht mit der Dunkelheit ständischer Verhältnisse
im Widerspruch. Optische Kontraste tragen dazu bei, Deutungen anzuregen. Es
versteht sich zudem, dass die großformatigen Wandbilder unterschiedlich auszu-
führen sind: eher flächenhaft unräumlich im Bereich gedichteter Sozialkritik, mit
perspektivierender Raumtiefe hingegen, wo Voß die Gestaltung oder Beschrei-
bung von Utopien erstrebt. Wandbilder, die antike Vorstellungsräume veranschau-
lichen, Wunschbilder einer besseren Wirklichkeit auf antikem Boden, benötigen
eine Tiefenkoordinate.
Eine Inszenierung muss verständlich sein, damit sie verstanden wird. Sie muss
sinngemäße Zusammenhänge erkennbar machen. Heinrich Ludwig Nicolovius,
befreundet mit Voß und dem Grafen Friedrich zu Stolberg, beobachtete 1793:
„Voß hasst den Adel und mag nur an griechischen Quellen seinen Durst löschen“.
8
Vossens Griechenbegeisterung – gespeist aus lebenslanger Kritik an Ständege-
sellschaft und Adelswillkür – das ist eine historische Linie, die wir sichtbar halten
müssen. Das ist eine Linie, auf welcher der Besucher diesem Griechen aus Meck-
lenburg entgegen gehen kann.
9
Wir halten diese Linie zum einen durch den Gang
der Inszenierung sichtbar. Zum anderen ziehen wir sie mittels authentischer oder
von uns kumulierter Voß-Aussagen. Selbstaussagen, von uns gegossen in die be-
schriebene Textsorte „Meine Feder“, markieren einzelne Phasen der Ausstellungs-
erzählung und unterstützen diese Linienzeichnung.
7
Es gehört zu den Einsichten des Zeitungen aus Übersee lesenden Landpfarrers im bürgerlichen
Epos „Luise“, dass das aktuelle Europa im Dunkel, Amerika hingegen im tagenden Lichte der
Menschheit liegt.
8
Zit. nach Wilhelm Herbst: Johann Heinrich Voß, Bd. 1, Leipzig 1872, S. 302.
9
Auch neueste Forschung belegt, dass Vossens Griechenbegeisterung und die seiner Zeitgenossen
aus dieser Perspektive angeboten und aufgenommen werden kann. Siehe z.B. die Habilitations-
schrift von Małgorzata Kubisiak: Die Idyllen von Johann Heinrich Voß. Idylle als poetologisches
Modell politischer Lyrik, Łódź, 2013, sowie die Dissertationsschrift von Enrica Fantino: „Je nä-
her ihm, desto vortrefflicher“ – Eine Studie zur Übersetzungssprache und -konzeption von Johann
Heinrich Voß anhand seiner frühen Werke, Manuskript, Leipzig 2015.









