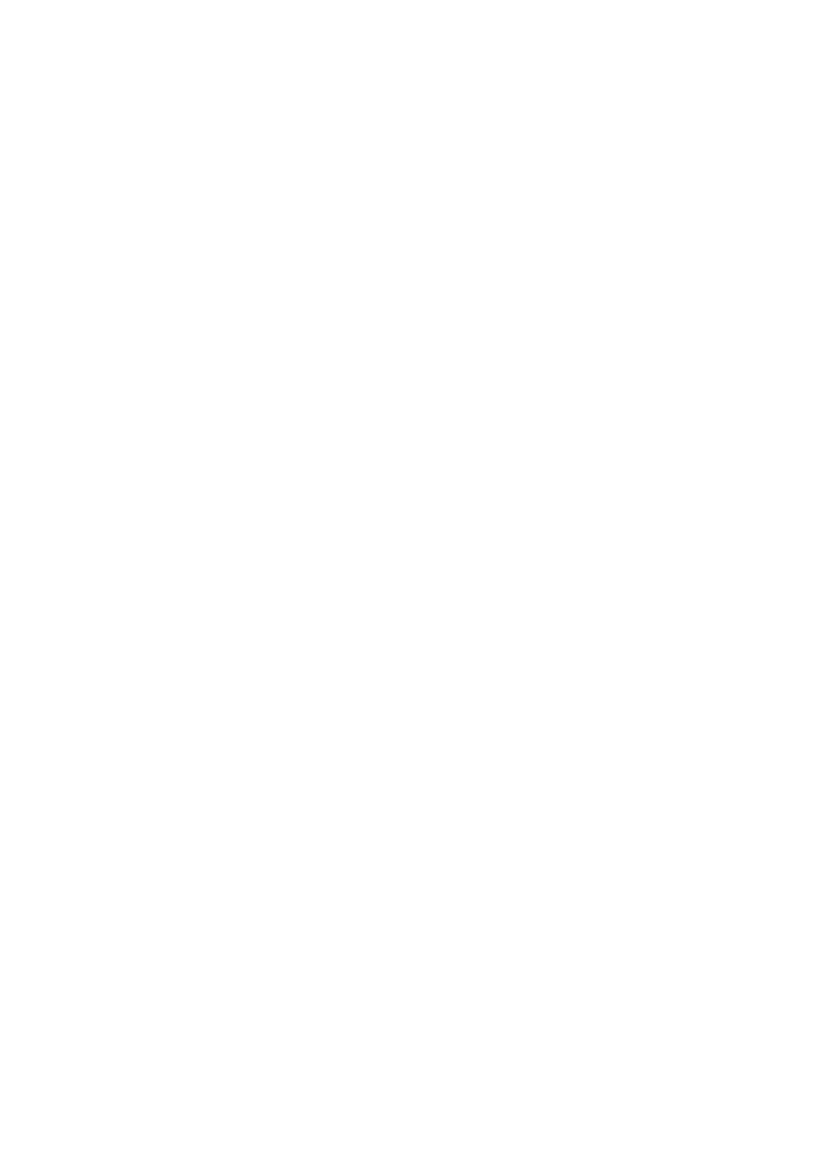
226
chungen in der Metallurgie, in der Botanik und untersuchte bereits gezielt Abfälle
menschlicher Besiedlungen. 1880 hat Virchow wichtige Befunde in der Arbeit
„Der Spreewald und die Lausitz“ (18) veröffentlicht. Dieser Aufsatz enthält nach
der für Virchow typischen Gesamtschilderung von Landschaft, Klima, Ethnologie
usw. die wesentlichen Ergebnisse seiner Grabungen. Im Museum der Westlausitz
in Kamenz und im Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte kann man Funde
besichtigen, die zum Teil aus der privaten Sammlung Rudolf Virchows stammen.
Rudolf Virchow war Anatom. In der
Kraniologie
traf sich sein spezielles Interesse
für menschliche Anatomie und Anthropologie. Er stand dabei natürlich auch im
geistigen Erbe seiner Zeit, das in der Form und Gestalt des menschlichen Schä-
dels Hinweise auf allgemeinere Merkmale des Individuums suchte. Oken und
Gall, zwei Kraniologen des frühen 19. Jahrhunderts, beeinflussten Virchows ana-
tomisches Verständnis. Die umfangreiche Sammlung, ca. 2.500 Schädel aus un-
terschiedlichen Zeiten und Weltteilen, diente vor allem der Suche nach äußeren
Merkmalen als Zeichen möglicher ethnischer Herkunft oder sogar qualitativer Ei-
genschaften. Früh musste Virchow feststellen, dass verbreitete Annahmen, wie do-
lichocephale Schädel seien germanischen, brachycephale slawischen Ursprungs,
nicht stimmen. Dies wurde im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen von
Gräberfeldern und auch bei der Untersuchung von Fundmaterial im Kaukasus
klar. Bei aller Raffinesse der damaligen Schädelvermessungen (5) mit zahlreichen
Messreihen konnte aus dem einzelnen Schädel kaum etwas zur ethnischen Zu-
gehörigkeit seines Trägers abgeleitet werden. Dies bestätigte sich später, wie wir
sehen werden, auch in der Troias. So blieb die Kraniologie Virchows und seiner
Zeitgenossen letztlich ein Irrweg in der anthropologischen Forschung. Er fand
keinen anatomisch definierbaren Urgermanen oder Urhellenen, „Vermischung der
Merkmale“ war vielmehr ein häufiges Phänomen, wie er auch in einem anderen
Zusammenhang, anlässlich der berühmten Schulkinderuntersuchung, abschlie-
ßend veröffentlicht 1886, feststellte (25). Wissenschaftliche Erkenntnis erwächst
häufig im Ausschlussverfahren, sie verliert durch diesen Weg jedoch keinesfalls
an Bedeutung.
Virchow war ein vorsichtiger Wissenschaftler, der sein Urteil nicht vorschnell ab-
gab. Dies wird besonders deutlich am Problem der Einordnung des Neandertalers.
Er hatte zunächst nur über den Fund von 1856 gelesen. Erst 1872 konnte er vor
der BGAEU nach einer fast illegalen Untersuchung der Knochenreste aus dem
Neandertal eine genauere Schilderung geben (20). Virchow hatte dabei aus heuti-
ger Sicht auf zwei Fragen zu antworten: Erstens handelt es sich um Knochen ei-
nes kranken oder gesunden Menschen, zweitens war dies ein „moderner“ Mensch
oder ein prähistorisches Wesen, wie bereits 1856 von Fuhlrott und dann von dem
Anatomen und Anthropologen Hermann Schaafhausen aus Bonn vermutet wurde









