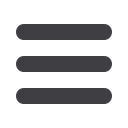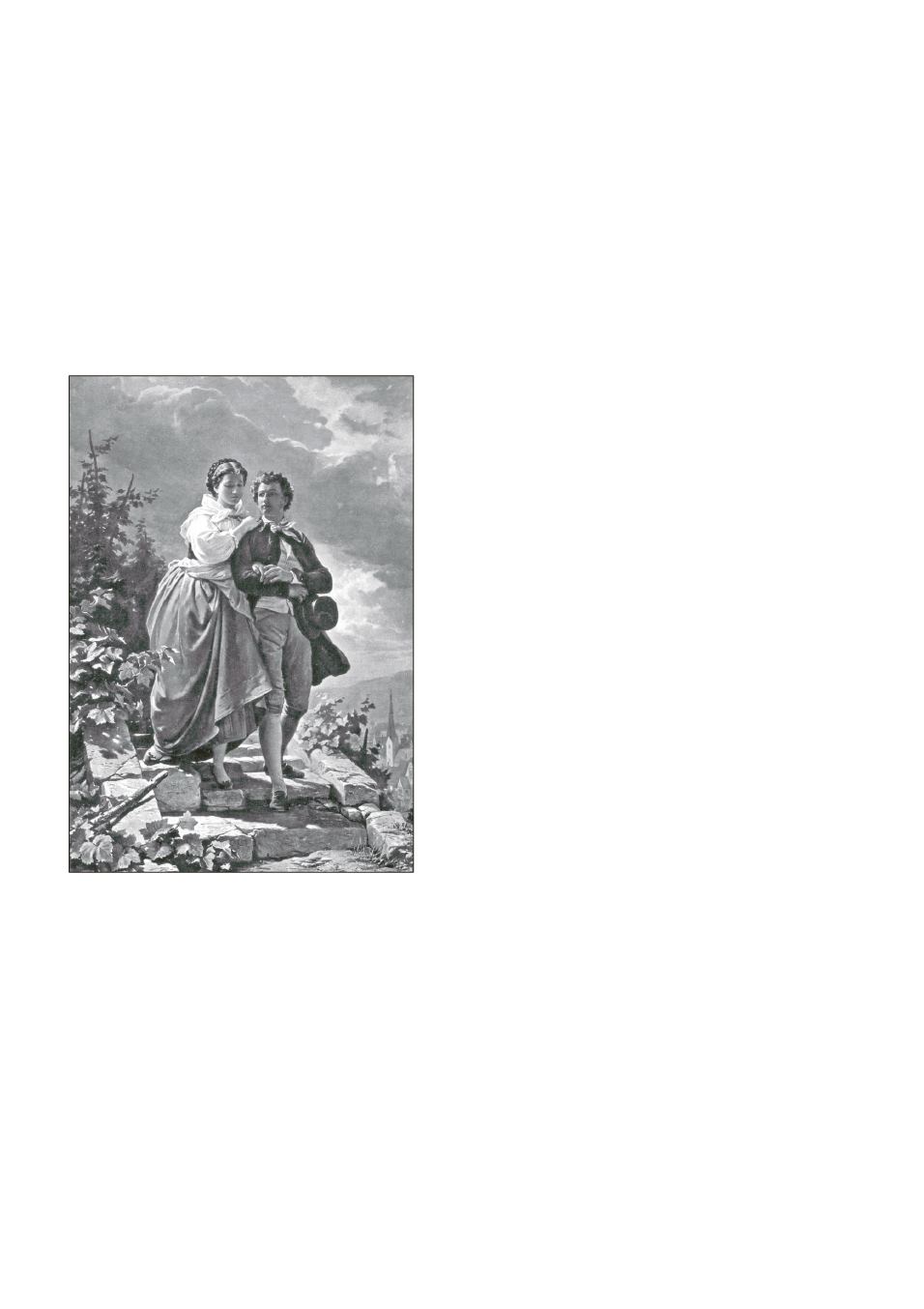
172
Die erste Frage ist, was meint Schliemann mit „unentbehrlich gemacht“? War er
schon unentbehrlich für Schröder, als er in Amsterdam Russisch gelernt hatte und
für ihn die russischen Kunden betreute? Er verdiente damals, wie er uns in seiner
Selbstbiografie erzählt, Fl. 1000 pro Jahr. Also zweimal soviel wie ein Stadtsekre-
tär, aber er versuchte nicht, Minna zur Frau zu bekommen. Am Ende seines ersten
russischen Jahres war er, im Vergleich zu seinem letzten Amsterdamer Jahr, sogar
ein reicher Mann. Er hielt aber nicht um Minnas Hand an. Nein, er versuchte ein
Russe zu sein. Er reiste nicht nach Mecklenburg, um Minna zu fragen, sondern
nach Paris und London, um die Welt zu sehen. Es ist klar, dass er im Jahre 1846
nicht an die versprochene Heirat mit Minna gedacht hat.
Weshalb Schliemann später erklärte,
dass Minna immer seine große Liebe
(vgl. Abb. 2) war, wird aus diesem Rei-
sejournal nicht klar. Es bestätigt nur, was
wir seit der großen Debatte der neun-
ziger Jahre bereits wissen. Man kann
Schliemanns Selbstbiografie nicht ohne
Vorsicht als eine historische Quelle be-
nutzen. Das ist an sich kein Wunder. Das
Genre der Autobiografie ist von Natur
aus unzuverlässig. Das im 19. Jahrhun-
dert in England hoch angesehene Gen-
re „Life and Letters“ wird allgemein
als so hagiografisch angesehen, dass es
nur durch das christliche Heiligenleben
übertroffen wird.
Damals war die große Frage, was alle diese „Lügen“ uns über Schliemanns Charak-
ter erzählen können. Ich glaube, dass dieses Reisejournal uns zeigt, Schliemanns
„Lügen“ waren nicht für uns, sondern für sein damaliges Publikum bestimmt.
Wenn wir wissen wollen, wie wir Schliemanns Selbstbiografie lesen und deuten
sollen, müssen wir erst die Frage klären, für wen sie bestimmt war.
Abb. 2 – Minna und Heinrich (?), s. Her-
mann und Dorothea – Heimkehr beim An-
zug des Gewitters, von Arthur von Ramberg