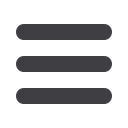89
hat er auch diese Geschichte mit seiner Phantasie ausgeschmückt. Andererseits
müssen wir auch ganz deutlich bemerken, dass Minna diese Beziehung
völlig
anders in Erinnerung hatte und empfand
. Das Gerücht bei den Nachfahren, sie
hätte lange auf Heinrich gewartet, lässt sich dagegen nicht erhärten. Aber Min-
na handelte und schrieb immer als verheiratete und später verwitwete Frau! Es
bleibt leider hier nicht die Zeit, auf Details einzugehen. Ich habe das an anderer
Stelle getan.
17
Freilich: Die „Minna-Erzählung“ ist – wie anderes bei Schliemann
auch – eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit, so hätte auch er, – wie einst
Geheimrat Goethe, seine Selbstbiographie nennen sollen. Aber im Großen und
Ganzen eignet sich gerade diese rührende Geschichte nicht dafür, Schliemann als
pathologischen Lügner zu bezeichnen.
Ein weiterer interessanter Aspekt in der Beurteilung Schliemanns stellt seine
Schilderung seiner Methode zum Erlernen von Fremdsprachen dar und dabei be-
sonders seine Behauptung, ganze Bücher auswendig gelernt zu haben: „Ivanhoe“
von Walter Scott und „The Vicar of Wakefield“ von Oliver Goldsmith zum Erler-
nen des Englischen, „Paul et Virginie“ von Jaques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
zum Erlernen des Französischen und schließlich „Aventures de Télémaques“ von
François Fénelon für das Französische und Russische.
18
Nachdem ich diese Bü-
cher in vier Sonntagsvorträgen behandelte, glaube ich nicht, besser: möchte ich
nicht glauben, dass überhaupt ein Mensch diese auswendig lernen kann.
19
Aber
Schliemanns Liebe zu Wissenschaften, zu alten Inschriften, seine Sehnsucht nach
einer intakten Familie und manche seiner Grundsätze und Lebensweisheiten rüh-
ren mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Beschäftigung mit diesen Werken her.
Thema des 86. Sonntagsvortrags war „Schliemanns Grundsätze – Was sagen sie
uns heute noch?“. Diese finden sich verstreut in Briefen und besonders in der
Ausschmückung seines Iliou Melathrons mit Inschriften.
20
Wir gehen davon aus,
dass Schliemann auch nach diesen handeln wollte und sie nicht anbringen ließ, um
17
In der Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor A. Jähne, die in Moskau erscheinen wird (im
Druck).
18
H. Schliemann, Ilios. Stadt und Land der Trojaner, Leipzig 1889, S. 11 f.
19
Schliemanns griechische Tochter Andromache behauptete: „Wir sassen zusammen in der
Eisenbahn, als er plötzlich von den Papieren aufschaute, in die er vertieft war. ‚Was liest du da?’,
fragte er [Schliemann – R. W.]. ‚Ivanhoe.’ ‚Lies mir einen Satz vor.’ Ich fing einen Satz an, und er
nahm ihn auf und sagte Seite um Seite des Buches, das ich in der Hand hielt, aus dem Kopf her.
Er hatte mit neunzehn Jahren, als er Englisch lernte, den ganzen Roman auswendig gelernt. Er
war jetzt über Sechzig, aber immer noch imstande, diese frühe Erinnerung wieder wachzurufen
und die Worte zu wiederholen, als lese er sie ab“ (Andromache Melas, Ein Mensch, den man
nicht vergisst. In: Readers Digest 3, 1950, Nr. 8, S. 35). Wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine
Nacherzählung eines Buches, sondern um die wörtliche Wiedergabe des Geschriebenen!
20
S. zuerst G. St. Korres, Les Inscriptions d’Iliou Mélathron. In: Euphrosyne Nova Serie-Volume
VII (1975/76), S. 153-167.