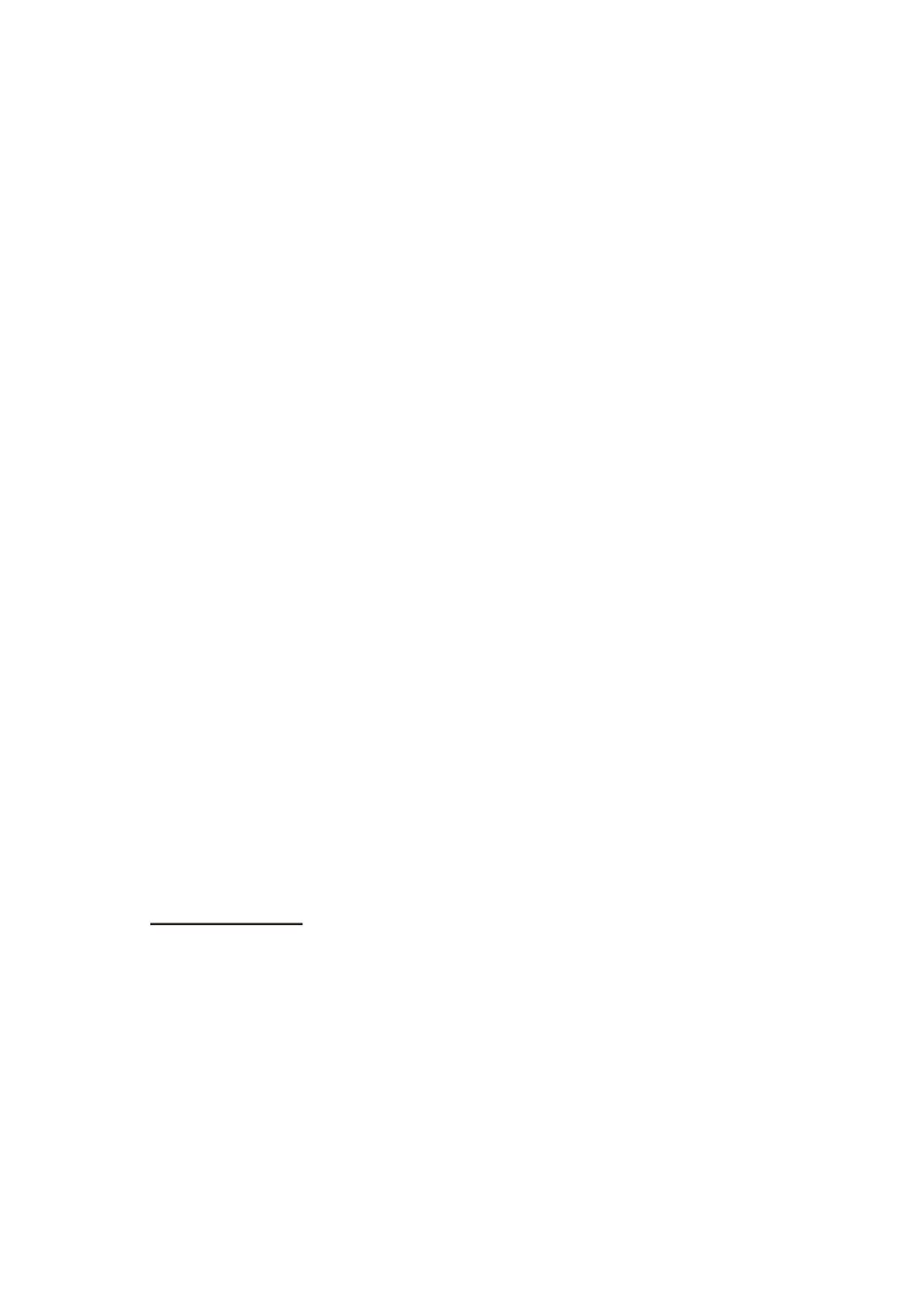
41
Werken. Alois Riegl (1858–1905) beispielsweise äußerte 1893 bezüglich paläoli-
thischer Kunst, dass es nicht Unzulänglichkeit war, die eine allein auf die Umris-
slinie betonte Darstellung erzeugte, sondern „von dem bestimmten Kunstwollen“
82
ausging. Riegl schreibt weiter: „Man wollte das Abbild eines Naturwesens in
todtem Material schaffen, und erfand sich hierzu die nöthige Technik“
83
. „Die
gesammte Kunstgeschichte stellt sich ja das als ein fortgesetztes Ringen mit der
Materie; nicht das Werkzeug, die Technik ist dabei das Prius, sondern der kunst-
schaffende Gedanke, der sein Gestaltungsgebiet erweitern, seine Bildungsfähigkeit
steigern will. Warum soll dieses Verhältnis, das die gesammte Kunstgeschichte
durchzieht, nicht auch für ihre Anfänge gelten?“
84
Riegls wichtiger Erkenntnis ei-
nes „Kunstwollens“ lassen sich auch Julius Langes (1838–1896) Beobachtungen
von „traits d’imperfection“
85
als ein Charakteristikum primitiver Kunst sowie der
ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeit der Frontalität zugesellen
86
. Ernst Grosse
(1862–1927) schließlich sieht künstlerische Eigengesetzlichkeit bei immer wie-
derkehrender „Unfähigkeit für die Auffassung und Darstellung natürlicher Formen
und Verhältnisse“ als ein Zeichen für bestimmte ästhetische Vorstellungen eines
Volkes
87
. Vorbehalte blieben dennoch, das merkt man nicht nur den eingangs zitier-
ten Äußerungen Collignons oder Wolters’ an. Riegl selbst äußerte zwar „der nach
den obersten Gesetzen der Symmetrie und des Rhythmus streng aufgebaute geo-
metrische Stil ist, vom Standpunkt der Gesetzmäßigkeit betrachtet, der vollkom-
menste“, relativiert dies aber gleich darauf mit „in unserer Wertschätzung steht er
aber am niedrigsten, und auch die Entwicklungsgeschichte der Künste, [...], lehrt,
dass dieser Stil den Völkern in der Regel zu einer Zeit eigen gewesen ist, da sie
noch auf einer verhältnismäßig niedrigen Entwicklungsstufe verharrten“
88
.
Durch die wachsende Zahl an ethnologischen Ausstellungen, aber auch durch die
lange wissenschaftliche Beschäftigung mit vorklassischer Kunst gelingt dennoch
die nüchterne Auseinandersetzung und vor allem Würdigung nicht nur für Früh-
kykladisches, sondern auch jeglicher primitiver Kunst
89
. Dies scheint sich auch in
den Museen verstärkt niederzuschlagen, denn ein wachsendes Interesse an Früh-
kykladischem belegt die zur Jahrhundertwende hin steigende Zahl an Ankäufen.
Nicht nur die Akquisen von Arthur Evans für das Ashmolean Museum Oxford wä-
82
Riegl 1893, 20.
83
Riegl 1893, 20. In der damaligen Diskussion ging man davon aus, dass erst durch Technik erzeugte
Muster, z. B. Webmuster, Anregung zu geometrischem Dekor schufen. Riegl stellt sich dem
entgegen und erkennt die Autonomie abstrakter Formen.
84
Riegl 1893, 24.
85
Lange 1899, IX.
86
Lange 1899, XII.
87
Grosse 1894, 24 f.
88
Riegl 1893, 3.
89
Schmalenbach 1961, 91. Vgl. auch Simmel 1896, 214.









