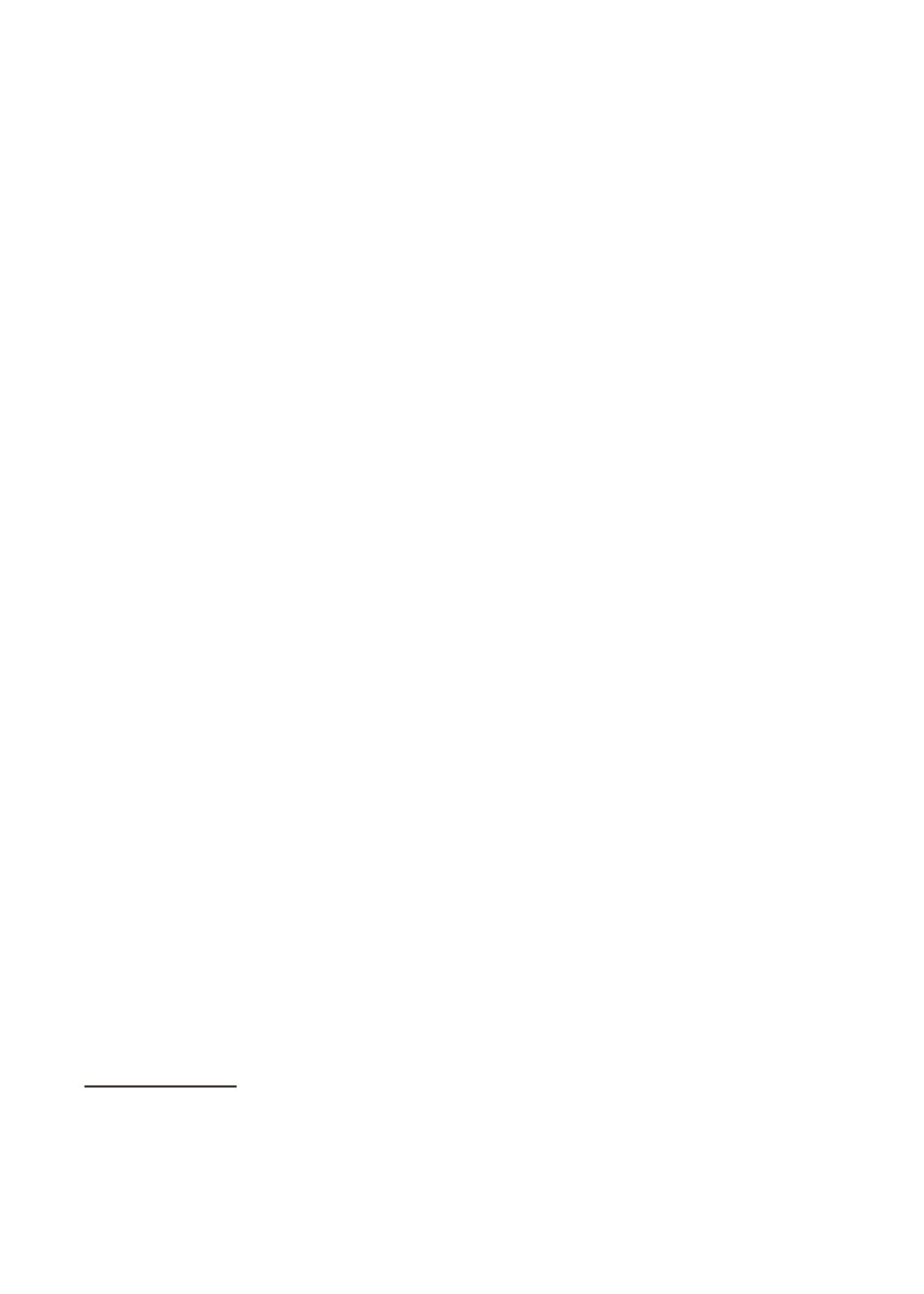
406
Am 5. Juli 1842 schloss er die Ehe mit Emilie Ries, die er 1841 in Frankfurt am
Main kennengelernt hatte.
Bereits ein Jahr später folgte die nächste Gründung, auch sie ist bis heute existent:
die
Archäologische Zeitung
. Von Gerhard als Publikation der neuesten Entdeckun-
gen angedacht, erscheint die Zeitung ab 1849 als Beiblatt des Archäologischen
Anzeigers und ab 1886
als Beiblatt des Jahrbuches des Deutschen Archäologi-
schen Institutes bis heute.
Zusammen mit Theodor Panofka berief ihn sein Förderer und Gönner Friedrich Wil-
helm IV. zum außerordentlichen Professor, ab 1844 zum ordentlichen Professor der
Berliner Universität. In seinen Vorlesungen konzentrierte er sich auf mythologische
Themen der Literatur und auf die Illustration von Vasenbildern. Hier waren seine
umfangreichen Kenntnisse der antiken Denkmäler von unschätzbarem Nutzen.
Während der Lehrtätigkeit an der Berliner Universität wurde ihm immer deutli-
cher vor Augen geführt, dass er sich von dem „Übervater“ der Philologie, August
Boeckh, abgrenzen musste. Er stand vor der Wahl, weiterhin als 5. Rad amWagen
der Philologie zu existieren oder die Archäologie als eigenständiges Fach zu etab-
lieren. Die Idee war nicht neu, denn 1837 erhielt Ludwig Ross
18
eine Professur für
Archäologie in Athen. In Berlin war seit 1810 mit Aloys Hirt zwar kein Archäolo-
ge, aber ein Wissenschaftler, der im Sinne von Johann Joachim Winckelmann die
Theorie und Geschichte der Künste lehrte. Mit diesem Anspruch sprengte er aber
nicht den „Alleinvertretungsanspruch der Philologie“, wie er von August Boeckh
verstanden wurde.
Gerhards Erfahrungen im Umgang mit August Boeckh hatten ihm gezeigt, dass er
einen anderen Weg beschreiten musste, wollte er die Archäologie als eigenstän-
diges Fach etablieren. Er wählte deshalb den Begriff „Monumentale Philologie“,
wenn er von der Archäologie sprach. Er hielt die Schaffung einer „institutionellen
Universitätsarchäologie“ für absolut erforderlich. Mit der Gründung einer priva-
ten Stiftung umging er notwendige Anträge auf finanzielle Mittel, die von Boeckh
mit Sicherheit nicht genehmigt worden wären.
Im Archäologischen Anzeiger Nr. 21 (Abb. 5) von 1850 beschrieb er seine Forde-
rung nach einem „archäologischen Lehr- und Übungsapparat für den eigentümlich
archäologischen Unterricht“.
19
Mit insgesamt 16 Thesen begründete er die Not-
wendigkeit eines solchen Apparates ausführlich.
18
Ross, Ludwig, (22.07.1806 – 06.08.1856), Klass. Philologe und Archäologe.
19
Gerhard, 1850, S 201ff.









