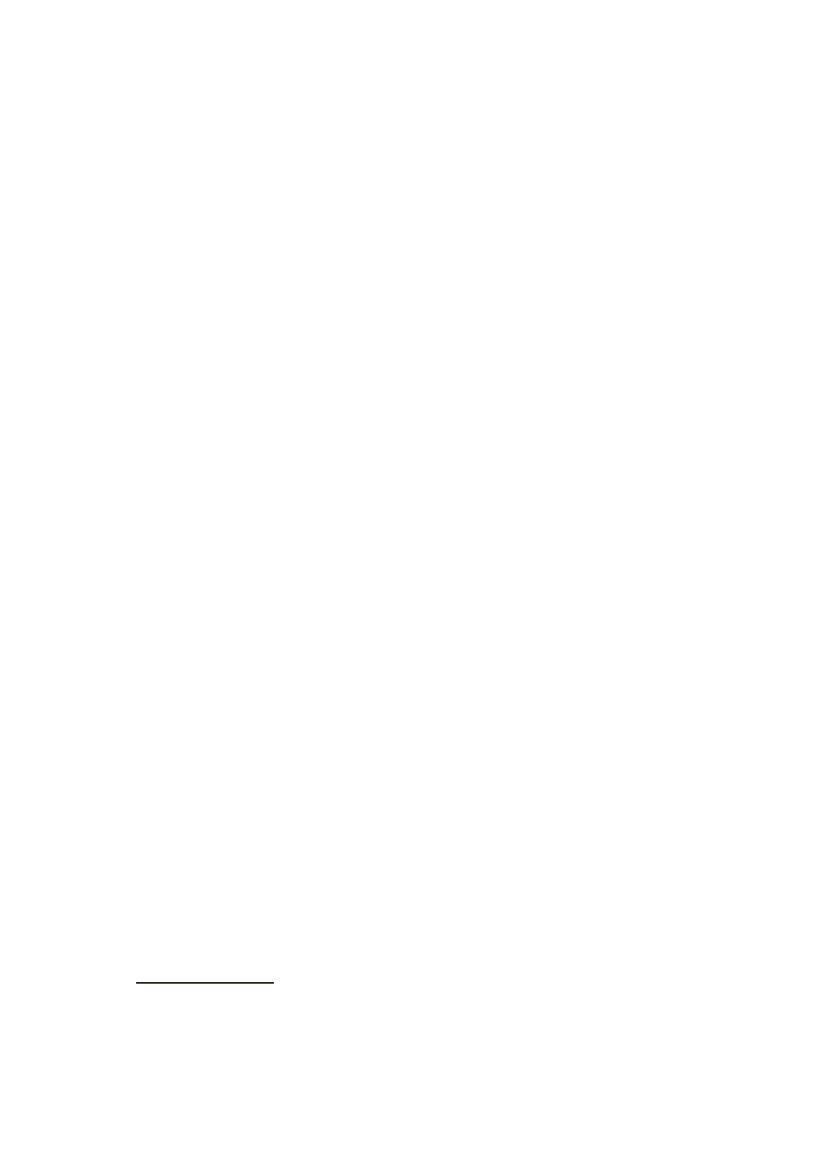
117
der Ernst, dem Weinhändler. Die Rauchwaren ließ er sich zusammen mit dem
ebenfalls georderten roten Bordeaux, den er gleich fassweise kaufte, nach St. Pe-
tersburg und Athen senden.
Der Multimillionär verlangte Sparsamkeit in der Haushaltsführung, pflegte aber
einen standesgemäß gehobenen, am Ende seines Lebens sogar luxuriösen Lebens-
stil.
Betroffen machen den heutigen Leser seiner Briefe Schliemanns rückständi-
ge und geringschätzige Äußerungen über die Frauen, obwohl er sich auf seinen
Amerikareisen über die dortigen gesellschaftlichen Fortschritte, z. B. die gemisch-
ten Klassen in den Schulen, sehr begeistert geäußert hat.
Bisher wurde in der Schliemannforschung die Meinung vertreten, dass Schlie-
manns widersprüchliche Begründungen in seiner Selbstbiographie für die frühe
„durch Zufall“
erlangte amerikanische Staatsbürgerschaft im Jahre 1851
21
auf ei-
ner Lüge beruhe, da er diese offiziell erst im Jahre 1869 erhalten habe. Es ist zu
vermuten, dass Schliemann, ähnlich wie bei der Benennung des Datums für die
Entdeckung des „Priamos-Schatzes“, versucht hat, eine Vorgeschichte zu inszenie-
ren, um unliebsame Folgen für seine auf unlautere Art und Weise in Indianapolis
erwirkte Ehescheidung zu verhindern. Die brieflichen Darlegungen Schliemanns
zur Erlangung seiner amerikanischen Staatsbürgerschaft geben Anlass, seine spä-
teren umstrittenen autobiographischen Äußerungen neu zu bewerten.
Vor uns entsteht das faszinierende Bild eines von einer Idee besessenen Menschen,
der sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, etwas Ungewöhnliches und Bleibendes
zu vollbringen. Dieses trotz widriger Umstände durch ständige Selbstüberwin-
dung, enorme Willenskraft und höchsten persönlichen Einsatz erreichte Lebens-
werk Schliemanns ist es, das uns auch heute noch Respekt und Achtung abver-
langt. Daran können auch Schliemanns charakterliche Fehler und Schwächen, die
in den Briefen deutlich zum Ausdruck kommen, nichts ändern.
Jeder Leser des Buches kann sich nun ein eigenes Urteil über den Menschen Hein-
rich Schliemann bilden. Dies wird ihm jetzt, wo er ihn besser und genauer ken-
nenlernen wird, eher möglich sein, als in der Vergangenheit. Ganz nahe kommt
man Schliemann aber nicht. Der Autor hofft, dass es ihm gelungen ist, mit seinen
Erkenntnissen „das Dunkel hinter dem Lichte“, wie es Emil Ludwig 1932 formu-
liert hat
22
, weiter zu erhellen!
21
Schliemann 1881, S. 15.
22
Ludwig 1932, S. 27.









